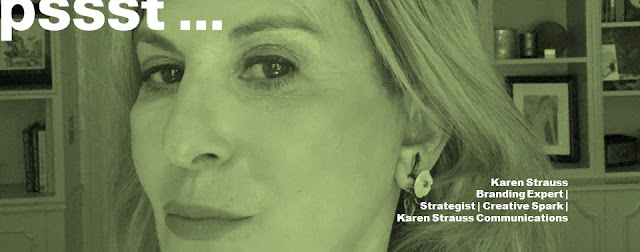Gegen den Wind: Warum es oft besser ist, eine Geschichte zu erzählen als auf Fakten zu vertrauen
Bezeichnend für die heutige Zeit ist, dass es immer schwieriger wird, Menschen von Neuem und von Innovationen zu überzeugen. Je mehr Informationen und Technologien uns zur Verfügung stehen, umso größer scheint der Widerstand zu werden und umso anspruchsvoller die Aufgabe, Menschen dafür zu begeistern.
Nancy Duarte vergleicht die Kunst des Geschichtenerzählens mit einem Segeltörn, der durchaus etwas Gegenwind vertragen kann. Auf einem Segelboot trägt der Skipper zwar die volle Verantwortung, er wird aber ohne die Segelmannschaft nicht weit kommen. Der Skipper legt die Reiseroute fest. Er muss genau wissen, wo Startpunkt und Ziel der Reise liegen und wo unterwegs die wichtigsten Anlegepunkte für das Boot sind. Ganz ähnlich arbeitet ein Storyteller. Auch er muss wissen, »wohin die Reise geht«, was Ausgangspunkt und Ende der Geschichte sind.
Er muss das Publikum nicht von Anfang an über die ganze Route im Detail informieren, aber bei den wichtigsten Wendepunkten der Story muss er auf seine Zuhörer Rücksicht nehmen, sie mitnehmen und immer wieder auf das Ziel der Rede einschwören. Storytelling erscheint oft wie ein Umweg, doch wirken Geschichten ganz besonders, wenn Skeptiker und Kritiker »an Bord« sind – wenn Gegenwind herrscht. Anstatt den direkten Weg zu wählen und mühevoll gegen den Wind zu segeln, was bei starkem Wind für ein Segelboot ohnehin aussichtslos ist, wählt der Segler den Zickzackkurs, was in der Segelsprache »kreuzen « heißt.
Um der vollen Wucht des Winds auf das Segel zu entgehen, steuert der Skipper sein Boot schräg zum Wind. Für den Laien mag das nach einer falschen Richtung aussehen, denn man steuert das Ziel nicht direkt an. Doch durch den ständigen Wechsel – das Wenden – von leicht schräger Fahrt nach links zu leicht schräger Fahrt nach rechts kommt das Boot langsam und beständig seinem Ziel näher.
Storytelling: Segeln gegen den Wind
Ganz ähnlich funktioniert eine gute Geschichte. Auch sie hört sich für den Zuhörer zunächst nach einem Umweg oder gar einer Themaverfehlung an. Denn den Kritikern im Publikum werden Argumente, Daten, Fakten und Beweise nicht direkt entgegengehalten. Stattdessen setzt der Storyteller auf eine Geschichte, die Vertrauen weckt, um zunächst einen emotionalen Zugang zu den kritischen Zuhörern zu bekommen. Erst wenn Aufmerksamkeit, Verständnis und Glaubwürdigkeit zurückgewonnen sind, kann ein neuer Versuch der Überzeugungsarbeit gestartet werden.
Stories liefern Skeptikern also nicht noch mehr Futter für ihre Kritik, stattdessen arbeiten sie intuitiv und emotional mit einem alternativen Zugang. Erst wenn der Kritiker vom Fokus seiner Kritik ablässt und bereit ist, zuzuhören, kann erneut ein rationales Argument eingebracht werden. Geschichten öffnen die Tür – für weitere Argumente. Wer Gegenwind spürt, sollte sich also mit guten Geschichten wappnen. Doch wo finden sich diese Stories, die selbst Kritiker überzeugen?
Reale versus fiktionale Geschichten
»If you can harness the principles of a well-told story, then you get people rising to their feet amid thunderous applause.« – Robert McKeeFragt man den Narrationsforscher Prof. Dr. Michael Müller von der Hochschule der Medien Stuttgart, gibt es zwei Kategorien von Stories für Unternehmen: wahre Geschichten und fiktionale Stories. Müller versteht darunter nicht Genres – wie etwa wahre Reportage oder fiktiver Roman. Ihm geht es darum, zu unterscheiden zwischen realen Stories, die tatsächlich in einem Unternehmen geschehen, und fiktionalen Geschichten, die meist das Management erzählen möchte.
Der Narrationsforscher hat dabei eine klare Präferenz: Auch wenn Visionen und Zukunftsstrategien des Managements interessant klingen, so sind die meisten dieser Erzählungen doch vorhersehbar und aus narrativer Sicht banal. Ihre Storylines sind getragen von Themen wie »Wir streben Marktführung an«, »Wir sind Innovationsleader«, »Wir sind ein Großkonzern mit Start-up-Kultur« etc. Viele dieser Narrative sind bekannt und schon oft erzählt. Der spannendere Schatz liegt für Müller dagegen in den realen Stories, die im Unternehmen stecken. Diese Geschichten können die gleiche Kernbotschaft ausdrücken, die auch eine Unternehmensvision erzählt. Doch sind sie in der Regel viel interessanter. Sie sind authentisch, zeigen reale Menschen und Mitarbeiter und handeln von kleinen und großen, vor allem aber menschlichen Dramen im Alltag. Und ihnen gelingt etwas, das fiktionalen Management-Stories oft verwehrt bleibt: Sie vereinen Erzähler, Protagonisten und Rezipienten und schaffen so eine hohe Identifikation mit der Story.
Als ehemaliger Mitarbeiter eines Weltkonzerns wie P&G weiß Paul Smith, wie schwierig es ist, Einfluss auf eine Unternehmenskultur zu nehmen. Daher sieht er Storytelling als Schlüssel zum Erfolg. Denn Geschichten sind Beispielerzählungen, mit denen es viel leichter fällt, so etwas Abstraktes wie »Kultur« oder »Wertvorstellungen« zu erfassen und zu verstehen.
»An organizations culture is defined by the behavior of its members and reinforced by the stories they tell. (...) If you want to create a stronger culture in your organization, find the stories that exemplify the culture you want to foster and share them broadly.«Und auch umgekehrt können Geschichten genutzt werden, um eine bereits vorhandene Unternehmenskultur sichtbar zu machen und zu verstehen. Prof. Dr. Michael Müller war einer der ersten Kommunikationswissenschaftler in Deutschland, der in den 90er-Jahren narrative Managementmethoden und Storytelling als Organisationsprinzip erforschte: »Wer sich mit Storytelling beschäftigt, erkennt Muster in den Stories und der Art, wie sie erzählt werden. Narrative spiegeln Verhaltensmuster wider, zum Beispiel von Mitarbeitern oder Kunden. Wer sie erkennt und sich bewusst macht, kann damit aktiv arbeiten.« Heute wird Storytelling als anerkannte Methodik in Change-Prozessen, in der Marken- und Projektsteuerung sowie im Wissensmanagement systematisch eingesetzt.
Immer steht Storytelling dabei vor der gleichen Aufgabe: der Reduktion von Komplexität. Corporate Stories erleichtern den Umgang mit komplexen Arbeitsabläufen, komplexen Gruppendynamiken und komplexen Marktfeldern. Geschichten helfen zu verstehen, was die Aufgabe des Unternehmens ist und welche Rolle es in dieser Welt spielt. Vor allem aber helfen sie, zu erkennen, was der eigene, ganz persönliche Beitrag dabei ist.
Bevor sich Unternehmen also mit ihren fiktionalen Zukunftsgeschichten auseinandersetzen, sollten sie, so Michael Müller, erst ihr Augenmerk auf die Gegenwartsgeschichten richten:
»Jedes Unternehmen braucht eine Zukunftsgeschichte, kein Zweifel. Doch diese gilt es nicht zu er-finden, sondern zu finden. Nur wer den narrativen Ausgangspunkt in der Gegenwart kennt, kann die Story in seinem Sinne auch verändern. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie fiktiv irgendetwas erzählen, das Ihnen niemand abnimmt. Suchen Sie erst die positiven Gegenwartsgeschichten in Ihrem Unternehmen. Es wird sich für Sie lohnen – in der Zukunft.«
Sie wollen selbst mehr erzählen – statt nur zu präsentieren? Dann lesen Sie doch gerne weiter. In dem Buch, aus dem dieser Text stammt: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019.
Und Sie wollen noch einen Talk zum Thema "Storytelling" ansehen? Dann interessiert Sie vielleicht mein aktueller TEDx-Talk "Über gutes Storytelling und die dunkle Seite des Erzählens".
Photo by Alfonso Escu on Unsplash