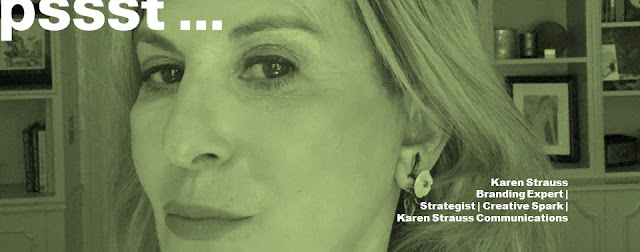15 Minutes Of Fame: Abtauchen in der visuellen Tsunami
Eine Frage an Sie: Blicken Sie doch einmal auf Ihr Handy und überprüfen Sie, wie viele Fotos Sie gespeichert haben. Schätzungen zufolge werden jährlich weltweit über eine Billion Fotos produziert. Jede Minute werden 200.000 Fotos auf Facebook gepostet. Alle 60 Sekunden kommen 42.000 Bilder auf Instagram dazu, und wenn Sie diese Zeilen lesen, sind diese Zahlen mit Sicherheit schon weiter angestiegen.
Laut Kodak wurden allein im Jahr 2011 mehr Bilder gemacht als in der gesamten Zeit davor - seit Erfindung der Fotografie. Joseph Nicéphore Niépce benötigte 1826 acht Stunden Belichtungszeit, sowie eine mit Naturasphalt bestrichene Zinnplatte in der Größe 20 x 25 cm und eine Mischung aus Lavendelöl und Petroleum, um das erste Foto der Welt mit einer Camera obscura zu fixieren.
Das Bild zeigt den Blick aus seinem Arbeitszimmer im französischen Saint-Loup-de-Varennes. Man erkennt den Rahmen des Fensterflügels, ein Taubenhaus, einen Baum, in der Ferne ein kleines Gebäude mit Pultdach und schließlich den Kamin eines Backhauses des Gutshofs, auf dem Niépce lebte und arbeitete. So unspektakulär das Motiv der Aufnahme ist, so bahnbrechend war die Technologie, die dieses Bild ermöglichte. Niépce gelang die erste dauerhafte und bis heute erhaltene Fotografie. Leider war es ihm nicht vergönnt, diesen Triumph voll auszukosten. Sein Partner Louis Daguerre stellte erst nach seinem Tod, am 19. August 1839, der Öffentlichkeit die neue Technik vor – dieses Datum markiert die Geburtsstunde der Fotografie.
160 Jahre später erreicht die Fotoindustrie ihren Höhepunkt. 1999 wurden laut 70 Millionen Kameras verkauft. und 80 Milliarden Fotos damit geschossen. Und das ist bekanntlich nicht das Ende des Fotobooms. 15 Jahre später, 2014, werden 10 mal mehr Geräte verkauft, mit denen man Fotos machen kann. Doch dies sind keine Fotokameras mehr: Mit Einführung der Fotofunktion in Smartphones geht ab dem Jahr 2000 die Ära der Fotokamera ihrem Ende entgegen.
Noch nie so viele Bilder
2014 besitzen 41 Millionen Deutsche ein »intelligentes Telefon«. In nur wenigen Jahren ist es dem Smartphone gelungen, zu unserem wichtigsten Gerät zu werden, einem Gerät, auf das wir nicht mehr verzichten können und wollen. (..) Zum Thema »Digitales Fotografieren« stellt eine Studie von Deloitte fest, »dass das Smartphone der dominierende Fotoapparat im Alltag geworden ist. Es dient allen Nutzern als Digitalkamera. Denn jeder Smartphone-Nutzer (100 Prozent) in Deutschland ab 14 Jahren macht mit seinem Gerät auch Fotos. Dieser Nutzungsgrad mag im ersten Moment unspektakulär anmuten, ist (...) aber bemerkenswert. 2011 machte gerade einmal gut jeder dritte Smartphone und Handy-Nutzer mit seinem Gerät auch Fotos.Heute verlieben wir uns angeblich nicht nur alle 11 Minuten, wir blicken im Durchschnitt auch 11 mal aufs Hand – über den Tag verteilt gucken wir zwischen 88 und 100 mal auf das Smartphone. Cirka vier Mal im Durchschnitt, um zu fotografieren. Smartphonefotographie erzeugt somit einen Strom von Bildern, einen Tsunami an Fotos, mit der noch keine Generation vorher konfrontiert war.
Bilder für alle wie Musik
Kommunikations- und Verhaltensforscher versuchen derzeit, unser neues Verhältnis zum Informationsträger Bild zu analysieren und die Auswirkungen dieser Veränderungen einzuschätzen. Noch ist das Phänomen des »Visual Turn« relativ jung. Doch Wissenschaftler sind sich einig, dass sich unser Rezeptionsverhalten langfristig grundlegend ändern wird.Einige ziehen Parallelen zur Erfindung des Vinyls Ende des 19. Jahrhunderts und dem Siegeszug der Schallplatte sowie die serielle Fertigung des Transistorradios Anfang der 50er Jahre. Beides hatte massive Auswirkungen auf den Umgang mit Musik. Denn all diese technischen Errungenschaften halfen der Musik, »laufen zu lernen«, und das Medium „Ton“ zu demokratisieren. Jahrhundertelang war Musik eine Kunstform, die von Musikern und professionellen Künstlern »in Echtzeit« ausgeübt wurde. Musik auf hohem Niveau war einer Elite vorbehalten, die sich entweder eine Eintrittskarte für den Konzertsaal oder das Opernhaus leisten konnte oder die sich die Künstler selbst ins Haus holte.
Ende des 19. Jahrhunderts machten die Schellackplatte und später die Vinylplatte aus Polyvinylchlorid (PVC) dann das Unmögliche möglich: Musik wurde konservier- und reproduzierbar. Mit einer Schallplatte und einem Grammophon oder Plattenspieler konnte man sich seine Lieblingsmusik und Musiker einfach und bezahlbar nach Hause holen. Schließlich brachte das tragbare Transistorradio Tonaufnahmen – Musik, Nachrichten oder auch Veranstaltungen und Sportereignisse – überall hin. Man konnte zuhören von wo man wollte. Erstmals waren Menschen live dabei, obwohl sie nicht vor Ort waren.
Ähnlich wie die Musik waren auch visuelle Ausdrucksformen wie Grafik, Foto und Film einst Künstlern und professionellen Anwendern vorbehalten. Diese Profis arbeiten mit aufwändigem, kompliziertem und teurem Equipment, dessen Bedienung eine Ausbildung und jahrlange Erfahrung erfordert. Heute wandelts sich das –jeder kann zum Grafiker werden, zum Fotografen und sogar zum Filmemacher– in nur wenigen Minuten, mithilfe eines Computers, eines Smartphones, der richtigen Software und ein paar Apps. Schon sind die Fertigkeiten der Profis – in gewissem Rahmen – für jeden zugänglich. Leicht zu bedienen und oft sogar kostenlos.
Revolution von unten
Doch der Vergleich mit der Vinyl hinkt: Die Schallplatte und das Radio befreiten den Ton aus dem Konzertsaal und ermöglichten einem breiteren Publikum Zugang zu professioneller Musik. Doch diese technischen Innovationen veränderten nur den Verbreitungsweg, nicht jedoch die Musikproduktion selbst. Schallplatte und Transistorradio brachten Musik in die Welt, damit sie überall und an jedem Ort zugänglich war und von jedem genossen werden konnte, doch die Musik selbst wurde und wird weiterhin von Künstlern und Musikern eingespielt.Zwar gibt es auch hier für Laien Computerprogramme und Apps, um zu komponieren, aufzunehmen und abzumischen, doch der Großteil der Musikproduktion bleibt nach wie vor einem Kreis von Profis vorbehalten und wird – »top down« – an das Publikum weitergegeben.
Die Flut der Bilder funktioniert jedoch genau andersherum: »bottom up«. Nicht nur Profis, sondern wir alle kreieren heute visuelle Inhalte. Wir gestalten mit Grafiken, Gifs und Emojis, nehmen Fotos auf und produzieren Filme. Mit Computer und Smartphon treten wir in den Wettbewerb mit Grafikern, Fotografen und Filmemachern und setzen uns sogar an ihre Stelle.
Joseph Beuys prophezeite, dass jeder Mensch zum Künstler werden würde, und Andy Warhol versprach jedem 15 Minuten Ruhm.
Beide Prophezeiungen gehen nun in Erfüllung – auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok.
Dabei ist besonders interessant zu beobachten, wie sich die Inhalte und Motive von Bildern, insbesondere Fotos und Filmen, durch die Demokratisierung der Mittel verändern. Als man noch einen teuren Fotofilm in die Kamera einlegen musste, war die Anzahl der Aufnahmen begrenzt und dementsprechend jedes einzelne Bild »kostbar«. Motive wurden sorgfältig ausgewählt. Fotografiert wurde nur zu besonderen Anlässen. Man ließ sich Zeit und arrangierte viele Aufnahmen. Visuell festgehalten wurde Herausragendes und Erinnerungswürdiges, fotowürdig waren die geplanten, besonderen Momente des Lebens.
Heute, da uns die Digitalfotografie ermöglicht, eine unbegrenzte Anzahl von Bildern zu machen, überwiegen Schnappschüsse, Spontanes, Beiläufiges, Alltägliches. Alles gerät ungefiltert ins Fadenkreuz der Kameralinse unseres Smartphones. Wir halten fest, wie wir leben, was wir essen, wie wir arbeiten, was wir in unserer Freizeit tun. Wir bilden Banalitäten ab. Wie wir aufstehen, frühstücken, aus dem Haus gehen, wieder heimkommen, zu Bett gehen. Wir dokumentieren, wo wir uns gerade befinden und mit wem wir zusammen sind.
Der Strom von Bildern ist Teil eines umfassenden Experiments: der Visualisierung und Dokumentation unseres Lebens in all seiner Alltäglichkeit und bis ins kleinste Detail. Wir verlagern unsere Erinnerungen und unser Selbstverständnis nach außen – in die Bilder, die wir auf unseren Smartphones speichern. Und es hat fast den Anschein, dass wir uns durch diese Bilder auch selbst bestätigen und uns vergewissern, dass wir existieren – durch Bilder, die wir in der Tasche tragen und die wir mit unseren Freunden und der Öffentlichkeit teilen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass vor allem ein Motiv immer und immer häufiger zu sehen ist: wir selbst.
Textauszug aus dem Buch „Visual Storytelling: Visuelles Erzählen in PR und Marketing“ von Petra Sammer und Ulricke Heppel, O´Reilly.
Videotipp
- »Joseph Beuys – Jeder Mensch ist ein Künstler« von Werner Krüger, 1979, http://bit.ly/1yoWyOu
- »15 Minutes: Andy Warhol«, Podiumsdiskussion zu Werk und Bedeutung von Andy Warhol, insbesondere´seiner Fotokunst, veranstaltet von der Columbia University und der Brand Foundation, Mai 2014, http://bit.ly/1G4Iv6T
Photo by JOSHUA COLEMAN on Unsplash