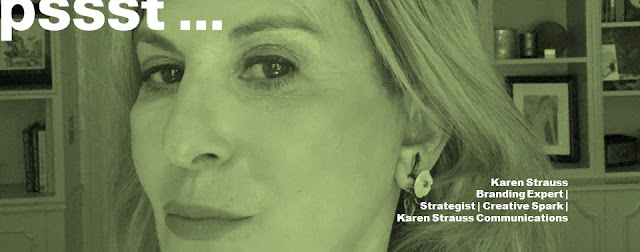„You go to hell and I go to Texas“ - Stories als Leucht- und Lagerfeuer

Stephen Denning ist Jurist. Und dies war leider nicht die beste Voraussetzung für die Sonderaufgabe, die ihm sein Arbeitgeber, die Weltbank, im Jahr 1996 zuwies. Nach erfolgreichen Jahren als Direktor des Afrikageschäfts wurde Denning befördert. Er sollte sich fortan um das Wissensmanagement der internationalen Entwicklungshilfe-Organisation kümmern mit dem Ziel, Wissen und Erfahrungen der Weltbank zu sammeln, zu systematisieren und zugänglich zu machen. Als erfahrener Manager tat Denning das, was die meisten in einer solchen Situation tun würden: Er entwarf eine PowerPoint-Präsentation. Darin gab er zunächst einen Überblick über Nutzen und Wertschöpfung von systematischem Wissensmanagement. Er errechnete den Wertverlust, den die Weltbank durch den kontinuierlichen Abgang an Mitarbeitern erlitt, und entwickelte einen Lösungsvorschlag: eine Wissensdatenbank, die im Intranet allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen sollte. Eine Vielzahl an Themen und Wissensfeldern sollte durch eine geschickte Verschlagwortung sortiert und den Mitarbeitern an allen Standorten der Weltbank zugänglich gemacht werden.
Denning hielt die Präsentation oft. Und er erzielte stets das gleiche Resultat. Sein Publikum stimmte den Fakten in allen Bereichen zu und dankte mit wohlmeinendem Nicken für den Vorschlag. Doch sobald die Zuhörer – Management oder auch Mitarbeiter – den Präsentationsraum verlassen hatten, passierte: nichts. Die Datenbank, die Denning aufbaute, wurde kaum genutzt, das Thema rutschte schnell wieder von der Agenda und geriet in Vergessenheit.
Plötzlich in Sambia
Die Reaktion des Publikums änderte sich jedoch schlagartig, als Denning seine PowerPoint-Präsentation wegwarf und stattdessen folgende Geschichte erzählte: Im Juni 1995 war er in Sambia unterwegs gewesen. In einem kleinen Dorf, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, lernte er einen der vielen ehrenamtlichen Gesundheitsberater kennen. Gesundheitsaufklärung ist eines der wichtigsten Themen in dieser Region. Denning musste mit ansehen, wie der Mann verzweifelt und vergeblich im Internet nach Informationen suchte, die er für den Kampf gegen Malaria benötigte. Denning wusste, dass die Weltbank über solche Informationen verfügt. Der Ehrenamtliche vor Ort kannte allerdings weder die Weltbank als Quelle für solche Informationen, noch wäre er zum damaligen Zeitpunkt auf der Website der Weltbank fündig geworden. Denning beendete seine wahre Geschichte mit einem Appell an die Zuhörer: Wäre es nicht fantastisch, wenn die Weltbank mit ihrem Wissen vor Ort unbürokratisch unterstützen könnte? Wäre es nicht viel hilfreicher, wenn sie nicht nur als Finanzgeber bekannt wäre, sondern vor allem als Wissensorganisation?Aus Dennings Sicht passierte Erstaunliches: Die kleine Anekdote aus Sambia überzeugte die Manager der Weltbank mehr als alle PowerPoint-Charts und Statistiken, die er bisher präsentiert hatte. Und sie war der Anfang eines langfristigen Veränderungsprozesses. Denning verwandelte die Weltbank in eine Storytelling-Organisation. Statt eine Datenbank anzulegen, professionalisierte er das Prinzip des Geschichtenerzählens in der Organisation, förderte den Austausch von Informationen und Erfahrungen mithilfe von Stories und krempelte gleichzeitig das Selbstverständnis der Organisation um. Die Weltbank verstand sich von da an nicht mehr nur als Finanzunternehmen, sondern zunehmend auch als Knowledge-Träger, dessen Wissen mindestens ebenso kostbar für die Kunden der Weltbank war wie Kredite und Finanz-Knowhow.
Stephen Denning hatte mit seiner Geschichte aus Sambia bei seinem Publikum drei entscheidende Effekte ausgelöst, die auch Psychologen so sehr an Storytelling faszinieren:
- Erfahrungsabgleich: Die meisten von Dennings Kolleginnen und Kollegen, die die Geschichte hörten, kannten die Situation, irgendwo in Afrika zu sein und helfen zu wollen. Viele von ihnen hatten ähnliche Erfahrungen gemacht – ein ganz entscheidender Grund dafür, dass die Story ihre Aufmerksamkeit weckte und sie sich mit ihr identifizieren konnten. Psychologen nennen diesen Effekt „Erfahrungsabgleich“ und er ist einer der wichtigsten Aspekte, warum Geschichten so kraftvoll sind und Interesse wecken.
- Stellvertreterlernen: Für alle diejenigen, die bisher nicht im Feld aktiv waren oder die bisher nicht in Afrika im Einsatz waren, bot die Geschichte die Gelegenheit des »Stellvertreterlernens«. Die Zuhörer konnten die Verzweiflung der Hauptfigur nachempfinden, die auf der schwierigen Suche nach relevanten Malaria Informationen war, sie konnten die Situation miterfahren. Auch dieser Effekt ist in der Psychologie sehr bekannt und unter Coaches sehr verbreitet – Patienten lassen sich wesentlich besser überzeugen, wenn Sie Erfahrungsberichte in Form einer Geschichte vermittelt bekommen, anstatt sie als nackte Fakten oder Lebensweisheiten präsentiert zu bekommen.
- Kontextualisierung: Ganz entscheidend aber ist der dritte Wirkmechanismus von Storytellling. Mit der Geschichte aus Sambia gelang es Denning, seine Kolleginnen und Kollegen auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, ein Ziel, das größer und bedeutungsvoller war, als nur eine Datenbank im Intranet zu programmieren. Es war die Vision einer »neuen« Weltbank, einer Organisation, die eine wesentlich bedeutendere Rolle spielen könnte, wenn sie sich in eine Wissensorganisation wandelte.
Kinderbetten und Lagerfeuer
Wir erfinden und erzählen Geschichten nicht für uns allein. Wir teilen sie. Geschichten wurden immer schon in der Gruppe – ob am Lagerfeuer in kleiner Runde oder vor großem Publikum – erzählt. Häufig werden sie im vertrauten Rahmen weitergegeben, auf Opas Knie schaukelnd oder als Gute-Nacht-Geschichte am Kinderbett. Aber auch auf Leinwand, Bühne und Podium. Geschichten entfalten erst dann ihre volle Kraft, wenn sie weitergereicht und wiedererzählt werden. Das Phänomen der »Shareability«, wie das Teilen in Facebook & Co. genannt wird, ist keine Erfindung des Internets. Gute Geschichten waren immer schon viral und werden – von Generation zu Generation, von Community zu Community, von Team zu Team – weitergegeben.Dieser Austausch ist einer der wichtigsten Rituale, um Gruppen zu formen und zusammenzuhalten. Die gleiche Geschichte zu kennen und sich gemeinsam auf sie beziehen zu können, wird zu einem entscheidenden Element der Gruppenidentität. Stories schweißen eine Gruppe zusammen – als Wissensgemeinschaft, als Fangemeinschaft, als Community.
So basieren alle Religionen auf einer Kerngeschichte oder einer Sammlung von Urmythen wie der Bibel, dem Koran oder den Traumzeitlegenden der australischen Aborigines. Religionsanhänger beziehen sich auf diese Geschichten und erkennen einander anhand des Wissens um diese Geschichten Auch nationale Identitäten beziehen sich auf Gründungsmythen und historische Narrative.
»Nationhood, everyone now seems to agree, is inseparable from storytelling.« – Patrick HoganViele dieser Erzählungen beziehen sich konkret auf Personen, wie Jeanne d’Arc oder Arminius, der im Teutoburger Wald das römische Heer besiegte. Oft sind es aber auch Geschichten zu Orten oder Bauwerken wie beispielsweise zu The Alamo, dem Fort in San Antonio, in dem 1836 ein kleiner Trupp Texaner gegen eine Übermacht von 7.000 Mexikanern um die Unabhängigkeit kämpfte. Nach zwei Wochen Belagerung wurde das Fort von den Mexikanern gestürmt, und alle 200 männlichen Texaner wurden getötet, unter ihnen der 49 jährige Kriegsheld und Politiker Davy Crockett, von dem der unter Texanern oft zitierte Spruch stammt: »You may all go to hell and I will go to Texas.«
Together. Forever. Social Bonding
Erzählungen können Gemeinschaft zwischen Menschen stiften, die sich nicht persönlich kennen. Erzählungen ermöglichen ihnen einen gemeinsamen, verbindenden Bezug zu Orten, Regionen und Nationalitäten.
Und auch Unternehmen beziehen ihre Identität und ihr Gruppengefühl oft aus Erzählungen. Gründungsmythen erweisen sich hier als extrem effektive Mittel der Sinn- und Gemeinschaftsstiftung.
Ein Beispiel ist die Geschichte von Taavet Hinrikus und Kristo Kaarmann, Gründer des Start-ups TransferWise. Hinrikus war einer der ersten Mitarbeiter von Skype Estland, er lebte und arbeitete aber in London. Sein Gehalt wurde ihm in Euro ausgezahlt, obwohl er in London dringend englische Pfund benötigte. Sein Freund Kristo Kaarmann arbeitete bei Deloitte in London und erhielt daher sein Gehalt in englischen Pfund. Weil er aber ein Haus in Estland abzuzahlen hatte, benötigte er dringend Euros. Den beiden wurde schnell klar, dass der Transfer ihres Gelds über Grenzen hinweg Unsummen an Gebühren verschlingen würde. Daher gründeten sie 2011 TransferWise, ein alternatives Geldtransfersystem, das günstiger und einfacher funktioniert als herkömmliche Geldtransfer- und Bankensysteme. Aus anfänglich zwei Mitarbeitern sind heute fast 2.200 in 14 Büros weltweit geworden, und seit 2017 ist das junge Start-up profitabel. Jeder der 2.200 Mitarbeiter kann die Geschichte von Taavet und Kristo erzählen.
Oder die Geschichte von Yvon Chouinard, einem Unternehmer, dem es Mühe bereitet, das Wort »Entrepreneur« auszusprechen. Nicht wegen des französischen Worts, sondern weil der Frankokanadier Unternehmer es eigentlich verachtet und alles andere werden wollte als ein Geschäftsmann. Chouinard ist Extremkletterer, und weil er für seinen Sport keine passende Bekleidung finden konnte, beschloss er, diese selbst zu produzieren. Nach einem Klettertrip in Südamerika gründete er 1973 seine eigene Firma: Patagonia. Die Geschichte vom Unternehmer, der kein Unternehmer sein will, kann jeder Patagonia-Mitarbeiter erzählen. Und die zahlreichen Stories, die sich um den Gründer der Marke ranken, dienen nicht nur der Positionierung der Marke des Outdoor-Labels, sondern sie unterstützen vor allem die Identifizierung der eigenen Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Der Titel der Biografie von Yvon Chouinard zitiert einen seiner berühmtesten Aussprüche – »Let My People Go Surfing« – und umschreibt genau das Lebensgefühl und Selbstverständnis des Unternehmens und seiner sportbegeisterten Mitarbeiter.
»Social Bonding« via Storytelling wirkt für Nationen, für Unternehmen, aber auch für viel kleinere Einheiten. Ein Redner, der die Kraft einer Geschichte richtig einzusetzen weiß, erzeugt im Präsentationsraum ein Gruppengefühl und ein gemeinsames Verständnis, das inspirierend, identitätsstiftend und motivierend wirken kann. Sie haben das sicher schon einmal erlebt: Ein Publikum verlässt am Ende eines begeisternden Vortrags den Konferenzraum. Die Kaffeepause steht an, und plötzlich kommt jeder mit jedem ins Gespräch. Schon beim Hinausgehen will man sich mit dem Nachbarn über das gerade Gehörte austauschen. Für einen kurzen Moment ist eine eingeschworene Gruppe entstanden, die sich auf eine Erzählung beruft. Storytelling ermöglicht den Zuhörern eine Gruppenerfahrung, die sie – wenn auch nur für einen kurzen Moment – vereint und zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißt.
Also – erzählen Sie mehr anstatt nur zu präsentieren.
Und lesen Sie weiter. Entweder in Stephen Dennings Buch: “The Springboard – How Storytelling Ignites Action in Knowledge”. Taylor & Francis, 2001 – oder aber in dem Buch, aus dem dieser Text stammt: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen 2019 bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal
Und auch Unternehmen beziehen ihre Identität und ihr Gruppengefühl oft aus Erzählungen. Gründungsmythen erweisen sich hier als extrem effektive Mittel der Sinn- und Gemeinschaftsstiftung.
Ein Beispiel ist die Geschichte von Taavet Hinrikus und Kristo Kaarmann, Gründer des Start-ups TransferWise. Hinrikus war einer der ersten Mitarbeiter von Skype Estland, er lebte und arbeitete aber in London. Sein Gehalt wurde ihm in Euro ausgezahlt, obwohl er in London dringend englische Pfund benötigte. Sein Freund Kristo Kaarmann arbeitete bei Deloitte in London und erhielt daher sein Gehalt in englischen Pfund. Weil er aber ein Haus in Estland abzuzahlen hatte, benötigte er dringend Euros. Den beiden wurde schnell klar, dass der Transfer ihres Gelds über Grenzen hinweg Unsummen an Gebühren verschlingen würde. Daher gründeten sie 2011 TransferWise, ein alternatives Geldtransfersystem, das günstiger und einfacher funktioniert als herkömmliche Geldtransfer- und Bankensysteme. Aus anfänglich zwei Mitarbeitern sind heute fast 2.200 in 14 Büros weltweit geworden, und seit 2017 ist das junge Start-up profitabel. Jeder der 2.200 Mitarbeiter kann die Geschichte von Taavet und Kristo erzählen.
Oder die Geschichte von Yvon Chouinard, einem Unternehmer, dem es Mühe bereitet, das Wort »Entrepreneur« auszusprechen. Nicht wegen des französischen Worts, sondern weil der Frankokanadier Unternehmer es eigentlich verachtet und alles andere werden wollte als ein Geschäftsmann. Chouinard ist Extremkletterer, und weil er für seinen Sport keine passende Bekleidung finden konnte, beschloss er, diese selbst zu produzieren. Nach einem Klettertrip in Südamerika gründete er 1973 seine eigene Firma: Patagonia. Die Geschichte vom Unternehmer, der kein Unternehmer sein will, kann jeder Patagonia-Mitarbeiter erzählen. Und die zahlreichen Stories, die sich um den Gründer der Marke ranken, dienen nicht nur der Positionierung der Marke des Outdoor-Labels, sondern sie unterstützen vor allem die Identifizierung der eigenen Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Der Titel der Biografie von Yvon Chouinard zitiert einen seiner berühmtesten Aussprüche – »Let My People Go Surfing« – und umschreibt genau das Lebensgefühl und Selbstverständnis des Unternehmens und seiner sportbegeisterten Mitarbeiter.
»Social Bonding« via Storytelling wirkt für Nationen, für Unternehmen, aber auch für viel kleinere Einheiten. Ein Redner, der die Kraft einer Geschichte richtig einzusetzen weiß, erzeugt im Präsentationsraum ein Gruppengefühl und ein gemeinsames Verständnis, das inspirierend, identitätsstiftend und motivierend wirken kann. Sie haben das sicher schon einmal erlebt: Ein Publikum verlässt am Ende eines begeisternden Vortrags den Konferenzraum. Die Kaffeepause steht an, und plötzlich kommt jeder mit jedem ins Gespräch. Schon beim Hinausgehen will man sich mit dem Nachbarn über das gerade Gehörte austauschen. Für einen kurzen Moment ist eine eingeschworene Gruppe entstanden, die sich auf eine Erzählung beruft. Storytelling ermöglicht den Zuhörern eine Gruppenerfahrung, die sie – wenn auch nur für einen kurzen Moment – vereint und zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißt.
Also – erzählen Sie mehr anstatt nur zu präsentieren.
Und lesen Sie weiter. Entweder in Stephen Dennings Buch: “The Springboard – How Storytelling Ignites Action in Knowledge”. Taylor & Francis, 2001 – oder aber in dem Buch, aus dem dieser Text stammt: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen 2019 bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal
Photo by Jakob
Owens on Unsplash