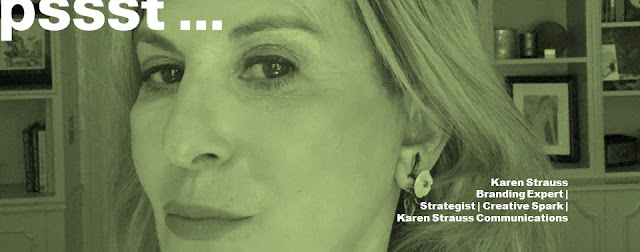Warum Führungskräfte mehr Geschichten erzählen sollten
Diane Morello und Mark Coleman, beide Analysten beim Markt- und Trendforschungsunternehmen Gartner, wagten 2017 einen Blick zehn Jahre in die Zukunft:
»By 2027, employees will be able to work and speak with team members across languages, borders and cultures, using avatars, language software, conversational interfaces and real-time dialect translation to translate and interpret with almost no loss of context or meaning. In this kind of system where people may not know one another, everyone will be rating each other (and being rated, in turn) on trust, competence and ethical behavior.«Dieses Szenario wird nun schneller Realität als wir dachten. Zwangsweise wegen Covid-19. Aber auch, wenn wir wieder in unseren Alltag zurückkehren, werden Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung, Arbeitsvirtualisierung, New und Agile Work sowie auch Design Thinking weiterhin unsere Arbeitswelt dramatisch verändern.
(…) All dies geht einher mit einem veränderten Informations- und Kommunikationsverhalten, das sich den neuen Arbeitsbedingungen anpassen muss. Drei Bereiche erweisen sich – in der Zukunft – mehr und mehr als neuralgische Punkte, die neue Kommunikationsmethoden und Techniken erfordern:
- Wegfall von Hierarchiestrukturen: Hierarchien verlieren (in virtuellen Teams und in New Work Strukturen) an Bedeutung und werden zum Teil sogar aufgelöst. Kommunikativ stellt sich dann aber die Frage: Wie bringt man ohne disziplinarische Durchsetzungsprinzipien ein Team hinter sich?
- Neue Teamkonstellationen: Teams der Zukunft werden passend zur Aufgabe immer wieder neu und interdisziplinär zusammengesetzt. Auch dies kann kommunikativ zum Problem werden, denn jedes dieser Teams muss sich schnell auf eine gemeinsame Arbeitsweise einigen. Wie kann man sich mit ganz unterschiedlichen Kollegen*innen auf gemeinsame Werte und Leitlinien verständigen, wenn meist die Zeit dazu fehlt und alles ganz schnell gehen muss?
- Zielkorridore statt präziser Vorgaben: Ziele werden zukünftig offener definiert, um auf Marktveränderungen flexibler reagieren zu können. Auch diese Forderung verlangt eine andere Art der Kommunikation: Wie sehen Projektbeschreibungen aus, wenn sie keinen Endpunkt definieren? Wie beschreibt man ein Ziel, ohne zu viel vorzugeben zu wollen oder zu können?
Lagerfeuer statt Hierarchie: Storytelling als Führungsinstrument
In der Vergangenheit belohnten Unternehmen Loyalität und Erfahrung. Auf diesen beiden Prinzipien basierte das Hierarchiesystem der meisten Firmen. Viele Vorgesetzte stehen auch heute noch ihrem Team vor, weil sie länger im Unternehmen sind oder weil sie mehr Erfahrung mitbringen als die restlichen Teammitglieder. Die Führungskraft hat in der Regel einen »Vorsprung« und kann so ihre Ausnahmestellung gegenüber dem Team rechtfertigen.Doch diese Prinzipien gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Unternehmen nehmen immer häufiger neue und junge Kollegen als Teamleiter in die Pflicht, da sie frisches Expertenwissen und unvoreingenommene Sichtweisen mitbringen. Oder aber sie lösen Hierarchien ganz auf und ersetzen sie durch unkonventionelle, partizipatorische Prinzipien zur Entscheidungsfindung.
»The best way to show themselves to their team is through storytelling.« – Lisa Johnson
Selbstkontrolle und Selbstorganisation sind angesagt. Dabei fällt der Führungsanspruch nicht komplett weg. Trotz der wachsenden Selbstbestimmung der Mitarbeitenden behalten Personalführung und Entscheidungskompetenz ihre Berechtigung. Auch wenn in flachen Organisationsstrukturen und hoch spezialisierten Special-Interest-Communities dezentral und mit geringerer Formalisierung gearbeitet wird, muss am Ende doch einer eine Entscheidung fällen. Auch in Peer-to Peer-Konstellationen gilt es, sich durchzusetzen. Tradierte Führungsinstrumente wie »Command and Control« funktionieren unter Gleichgestellten selbstverständlich nicht mehr. Stattdessen wird mithilfe von Gruppendiskussionen abgewogen und abgestimmt.
Doch was sich hier rational und logisch anhört, hat auch Nachteile: Diskussionen finden in der Regel keineswegs objektiv entlang der Sachlage statt, und sie brauchen Zeit.
Der Wirtschaftswissenschaftler Stephen M. R. Covey wies bereits 2006 auf die Bedeutung von Geschwindigkeit als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen hin. Und gab eine überraschende Antwort auf die Frage, wie man Produktivität und Innovationskraft beschleunigen kann: In seinem Buch »The Speed of Trust« nennt Covey den Faktor »Vertrauen« als entscheidendes Kriterium, um die Entscheidungsgeschwindigkeit im Unternehmen zu erhöhen.
Coveys Thesen zufolge gewinnt ein Unternehmen massiv an Planungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit, wenn es gelingt, eine starke Vertrauenskultur innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Wer sich zukünftig in der neuen Arbeitswelt mit ihren partizipatorisch geführten Teams durchsetzen will, braucht vor allem eines: Vertrauen. Vertrauen ist die Legitimation, im Team zu informieren, zu inspirieren und zu motivieren. Teams werden nur der Person folgen, der sie am meisten vertrauen und auch etwas zutrauen. Doch wie Vertrauen gewinnen? Kreativcoach Todd Henry hat für Manager und Führungskräfte hierfür einen einfachen Rat: »Do tell a story.« Henry fordert Führungskräfte auf, sich bei ihrem Team mit einer eigenen Geschichte vorzustellen – und dabei wirklich persönlich zu werden. In seinem Buch »Herding Tigers. Be the Leader that Creative People need« wird er konkret:
Doch was sich hier rational und logisch anhört, hat auch Nachteile: Diskussionen finden in der Regel keineswegs objektiv entlang der Sachlage statt, und sie brauchen Zeit.
Der Wirtschaftswissenschaftler Stephen M. R. Covey wies bereits 2006 auf die Bedeutung von Geschwindigkeit als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen hin. Und gab eine überraschende Antwort auf die Frage, wie man Produktivität und Innovationskraft beschleunigen kann: In seinem Buch »The Speed of Trust« nennt Covey den Faktor »Vertrauen« als entscheidendes Kriterium, um die Entscheidungsgeschwindigkeit im Unternehmen zu erhöhen.
Coveys Thesen zufolge gewinnt ein Unternehmen massiv an Planungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit, wenn es gelingt, eine starke Vertrauenskultur innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Wer sich zukünftig in der neuen Arbeitswelt mit ihren partizipatorisch geführten Teams durchsetzen will, braucht vor allem eines: Vertrauen. Vertrauen ist die Legitimation, im Team zu informieren, zu inspirieren und zu motivieren. Teams werden nur der Person folgen, der sie am meisten vertrauen und auch etwas zutrauen. Doch wie Vertrauen gewinnen? Kreativcoach Todd Henry hat für Manager und Führungskräfte hierfür einen einfachen Rat: »Do tell a story.« Henry fordert Führungskräfte auf, sich bei ihrem Team mit einer eigenen Geschichte vorzustellen – und dabei wirklich persönlich zu werden. In seinem Buch »Herding Tigers. Be the Leader that Creative People need« wird er konkret:
»Leaders should reveal something about themselves, that the team may not have previously heard. The goal isn’t just to tell stories, it’s to provide context and connection for your team. (...) Do tell a story.« – Todd Henry
Narrativ statt Instruktion: Storytelling als Teambuilder
(…) Seit Anfang der 80er-Jahre verwenden Kommunikationswissenschaftler den Begriff »Narrativ« für mehr als das, was im Duden steht. Aus dem neutralen Wort »erzählend« wird heute im Geist von Jean-François Lyotard, dem Gründervater der Postmoderne, eine »grand récits«, eine Metaerzählung.Darunter versteht man Helden- oder Entwicklungsgeschichten, die für Gemeinschaften, Nationen oder Teams bedeutsam und gemeinschaftsstiftend wirken. Ganz ähnlich funktionieren Stories in Unternehmen. Wie die Geschichte eines Produktteams, das eine ganze Nacht lang mit einer Präsentation kämpft, die der Kunde am nächsten Morgen spontan absagt. Die Arbeit war umsonst, aber der Teamspirit hat davon profitiert. Oder wie die Geschichte eines Außendienstmitarbeiters, der zur Hochzeit der Tochter eines Kunden eingeladen ist und dafür 200 Kilometer Anreise in Kauf nimmt. Das Auftragsvolumen ist nicht groß, aber er behandelt jeden seiner Kunden wie seinen engsten Freund. Oder aber die Geschichte eines Kollegen, der taub ist, und doch im Werksorchester Violine spielt. Und die Geschichte eines Bankvorstands, der nachdenklich von einer Familienfeier am Wochenende in sein Vorstandsbüro zurückkehrt. Einer Familienfeier, auf der er sich vor seinem eigenen Sohn und seinem Neffen zur Ethik des Finanzwesens rechtfertigen musste. »Narratives Management« ist die Kunst, reale Geschichten bei Mitarbeitern, Kunden und Partnern aufzuspüren, neue Geschichten hinzuzufügen und diese sinn- und gemeinschaftsbildend einzusetzen.
In der Arbeitswelt von morgen, in der Teams extrem inhomogen und variabel zusammengesetzt werden, in der Kollegen asymmetrisch und flexibel über verschiedene Bereiche und Abteilungen hinweg kommunizieren müssen – in so einem komplexen Umfeld ist es entscheidend, sich schnell auf gemeinsame Werte und Leitlinien zu einigen. Althergebrachte Informationssysteme wie Organigramme, Arbeitsanweisungen und Lastenhefte versagen dabei zunehmend.
»Perhaps the most powerful role of stories today is to ignite and drive changes in management policy and practices.« – Booz AllenNarrative – Geschichten, die gemeinschaftsbildend wirken – bieten sich hier als interessante Alternative an. Denn sie sind bereits jetzt die inoffiziellen Orientierungspunkte in Teams und Unternehmen. Die Stories, die auf dem Flur und in der Kaffeeküche erzählt werden, belegen die wahren Werte einer Organisation und verdeutlichen, welche Leistungen tatsächlich Wertschätzung erfahren und welche nicht. Diese Narrative sollte man nicht dem Zufall überlassen. Sie sollten sie stattdessen bewusst mitgestalten und geschickt nutzen, um Ihr Team zu stärken und geschlossen auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören.
Erzählraum statt Fixpunkt: Storytelling als Navigationssystem
Marktbedingungen verändern sich rasant, und das Innovationstempo zieht kontinuierlich an. Die Folge ist eine ständige Neuorientierung und Neuausrichtung von Geschäftsfeldern und Businessmodellen. Statt dogmatischer Planorganisation ist agiles, flexibles Projektmanagement gefordert. Unternehmen müssen heute spontan und unkompliziert auf neue Erfordernisse reagieren. Statt unverrückbarer, fixer Zielpunkte gilt es, Entscheidungsräume und Leitplanken zu definieren. Doch wie steuert man einen offenen, dynamischen Prozess, ohne dabei die Richtung zu verlieren?»Stories enable us to create order out of our world.« – Tham Khai Meng, Chief Creative Officer Ogilvy & Mather
Patti Sanchez, Chief Strategy Officer der Kommunikationsagentur Duarte, empfiehlt Storytelling als adäquate Kommunikationsstrategie:
»Storytelling can (...) help us conceptualize the future. In leaders’ hands, great stories can help guide teams through long-term changes. (...) They see their companies’ journeys as grand stories, with their teams playing an active role in the narrative. Just as a narrator guides readers through a novel, offering enough information to understand what’s happening and stay interested, a good leader serves as a torchbearer, lighting the way for a group of people and keeping them moving toward a common goal.«Geschichten helfen, die Richtung zu weisen. (…) Oft sind es sogar die kleinen Anekdoten und individuellen Geschichten, die ein Ziel verdeutlichen. Agiles Arbeiten verlangt nach einer Core-Story, einer Geschichte, die zu Beginn eines Projekts als Anschubkommunikation dient und die zwischen den Sprints immer wieder als Motivator und sinnstiftender Orientierungspunkt wirkt. Die Zieldefinitionen der Zukunft sind daher keine unverrückbaren Endpunkte, sondern narrative Entscheidungsräume und Erzählwelten. Es sind Erzählräume und User-Stories, die erläutern, warum ein Team an einem Projekt arbeitet, wie die Rahmenbedingungen für den Erfolg aussehen und welchen Mehrwert die Projektlösung am Ende bieten wird.
Warum Führungskräfte mehr Geschichten erzählen sollten
Na, neugierig geworden? Konnte ich Ihr Interesse für Storytelling im Businessumfeld wecken? Haben Sie Lust, Ihre Kommunikationstechniken und -tools auszubauen und Storytelling als rhetorische Technik näher kennenzulernen? Dann: herzlich willkommen. (…)»People don’t want more information. (...) They want faith – faith in you, your goals, your success, in the story you tell. It’s the faith that moves mountains, not facts.« – Annette Simmons
Ganz egal ob Web-Konferenz, Videobotschaft, PowerPoint-Präsentation oder Elevator Speech ... ausschlaggebend bei all diesen Persuasionsformen ist nicht mehr nur die pure Informationsübermittlung. Es reicht nicht mehr, Wissen einfach nur weiterzureichen. Wer erfolgreich kommunizieren will, dem muss es gelingen, Wissen beim Zuhörer auch zu verankern, merkfähig abzuspeichern und motivierend einzuordnen.
Und Geschichten eignen sich dafür ganz hervorragend.
(Lesen Sie gerne weiter, denn dieser Text stammt aus dem Buch: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal – ganz wie Sie wollen.)
Und Geschichten eignen sich dafür ganz hervorragend.
(Lesen Sie gerne weiter, denn dieser Text stammt aus dem Buch: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal – ganz wie Sie wollen.)