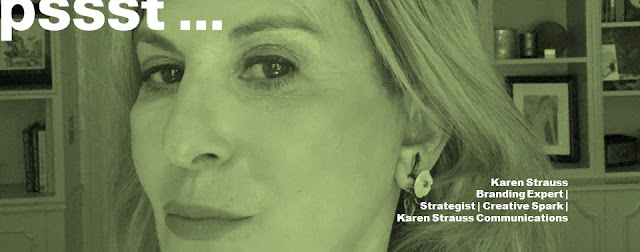Glossar der neuen Wirklichkeit
Wir leben in neuen Zeiten. Geopolitisch, wirtschaftlich, sozial. Vor allem aber sprachlich. Und das hat viel mit den neuen Machtverhältnissen in den USA, aber auch in anderen Regionen dieser Welt zu tun (über 70 % der Weltbevölkerung leben in Diktaturen oder autokratischen Systemen).
Sprache wird durch Machtverhältnisse geprägt. Sprache und Kommunikation ändern sich aber auch mit dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in fast allen westlichen Demokratien.
Und selbstverständlich spielen auch Algorithmen der Social-Media-Plattformen eine Rolle. Es sind ganz neue Zeiten – eine neue Wirklichkeit. Auch für Kommunikationsprofis in PR und Marketing.
Es ist dringend geboten, die Ausprägungen, Strategien, Taktiken und Wirkungsweise dieser neuen Sprache zu lernen … und deren Fachbegriffe:
Deny and Deflect - Taktik des Abstreitens und Ablenkens: Um eigene Versäumnisse zu vertuschen, streitet man Fakten einfach ab, ignoriert oder leugnet sie. Dann lenkt auf einen ganz anderen Aspekt, oder erfindet sogar falsche Fakten. Am erfolgreichsten ist die Doppelstrategie der erfundenen Ablenkung: dabei lenkt man nicht nur von dem eigentlichen Thema ab, indem man ein anderes Thema einbringt, sondern man präsentiert eine so offensichtliche und dreiste Lüge, die für so weitere Aufregung (und Ablenkung) sorgt. Beispiel: „Joe Biden habe Küken töten lassen und so die Eierpreise absichtlich nach oben getrieben. In Wahrheit ist jedoch die Vogelgrippe schuld, die die derzeitige Regierung bekämpfen sollte.“
Herrschaft des Tumults: Es herrscht das Primat des Augenblicks. Politiker (und Unternehmer) werfen ständig einen Blick aufs Stimmungsthermometer – und die Stimmungslage, an der sich alle orientieren, wird medial auch noch verstärkt. In den vier Jahren einer Legislaturperiode herrscht Dauerwahlkampf. Die Zeit, in der Politiker wirklich agieren, scheint zusammengeschmolzen.“ (Herfried Münkler im SZ-Interview am 8.3.2025)
Zone Flooding – Strategie der Überforderung: Steve Bannon gilt wohl als Vater dieser Kommunikationstaktik. 2019 sagte Bannon dem Fernsehsender PBS: „Flood the zone with shit ... Alles, was wir tun müssen, ist: Den Raum überfluten, jeden Tag. Drei Dinge auf einmal tun. Wenn sie sich an einer Sache festbeißen, erledigen wir schon die nächste“. Der US-Publizist Jonathan Rauch spricht von einer „Strategie der Desorientierung“ durch permanente Desinformationen, Lügen und Provokationen. Ziel sei es, Verwirrung zu stiften und das Misstrauen der Bevölkerung in traditionellen Medien weiter zu untergraben. (Deutschlandfunk Feb 2025)
Deny and Deflect - Taktik des Abstreitens und Ablenkens: Um eigene Versäumnisse zu vertuschen, streitet man Fakten einfach ab, ignoriert oder leugnet sie. Dann lenkt auf einen ganz anderen Aspekt, oder erfindet sogar falsche Fakten. Am erfolgreichsten ist die Doppelstrategie der erfundenen Ablenkung: dabei lenkt man nicht nur von dem eigentlichen Thema ab, indem man ein anderes Thema einbringt, sondern man präsentiert eine so offensichtliche und dreiste Lüge, die für so weitere Aufregung (und Ablenkung) sorgt. Beispiel: „Joe Biden habe Küken töten lassen und so die Eierpreise absichtlich nach oben getrieben. In Wahrheit ist jedoch die Vogelgrippe schuld, die die derzeitige Regierung bekämpfen sollte.“
Herrschaft des Tumults: Es herrscht das Primat des Augenblicks. Politiker (und Unternehmer) werfen ständig einen Blick aufs Stimmungsthermometer – und die Stimmungslage, an der sich alle orientieren, wird medial auch noch verstärkt. In den vier Jahren einer Legislaturperiode herrscht Dauerwahlkampf. Die Zeit, in der Politiker wirklich agieren, scheint zusammengeschmolzen.“ (Herfried Münkler im SZ-Interview am 8.3.2025)
Zone Flooding – Strategie der Überforderung: Steve Bannon gilt wohl als Vater dieser Kommunikationstaktik. 2019 sagte Bannon dem Fernsehsender PBS: „Flood the zone with shit ... Alles, was wir tun müssen, ist: Den Raum überfluten, jeden Tag. Drei Dinge auf einmal tun. Wenn sie sich an einer Sache festbeißen, erledigen wir schon die nächste“. Der US-Publizist Jonathan Rauch spricht von einer „Strategie der Desorientierung“ durch permanente Desinformationen, Lügen und Provokationen. Ziel sei es, Verwirrung zu stiften und das Misstrauen der Bevölkerung in traditionellen Medien weiter zu untergraben. (Deutschlandfunk Feb 2025)
Bullshit: Sonderform des "Zone Floodings". Hier werden nicht nur wahre und falsche Informationen vermischt, sondern die Falschheit ist auch noch in sich widersprüchlich. Das heißt, man versucht nicht einmal mehr, widerspruchsfreie Unwahrheiten zu behaupten. Diese extreme Form des "Zone Flooding" führt, laut den Studien von Helen Fischer, Kognitionspsychologin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, dazu, dass Bürgerinnen und Bürger leichtgläubiger werden und stärker dazu neigen, Aussagen zunächst für wahr zu halten, egal wie falsch sie sind. Der Effekt ist stärker ausgeprägt als bei klassischer Propaganda und zeigt, wie gefährlich diese Methode ist (ZDF Interview 1.3.2025).
Postfaktizität: In Europa wird ab dem Jahr 2016 von dem postfaktischen Zeitalter gesprochen, Auslöser waren die Falschinformationen rund um den Brexit, sowie die kommunikative Taktik im US-Wahlkampf 2016. Auch Angela Merkel benutzte 2016 erstmals das Wort postfaktisch – im Zusammenhang mit Falschaussagen der AfD. In den USA taucht der Begriff erstmals 1999 in dem Artikel Can Democracy Survive in the Post-Factual Age des Kommunikationswissenschaftlers Carl Bybee auf. Doch schon seit 1922 gibt es eine wissenschaftliche Debatte und Forschung darüber, welche Rolle Lügen in der öffentlichen Meinungsbildung und im politischen Willensbildungsprozess in den USA spielen. Insbesondere wird immer wieder untersucht, welche Rolle der Journalismus in einer Demokratie hat, und so auch die Frage, wie viel politische Verantwortung einer Wählerschaft zuzutrauen sei, die aufgrund mangelnder Bildung für die Suggestionen ihrer politischen Führer mehr als anfällig ist (Wikipedia). Der Beginn des 21. Jahrhunderts manifestiert unumstößlich das postfaktische Zeitalter, in der Realität und Fiktionalität ineinander übergehen und von Rezipienten kaum mehr unterscheidbar sind.
Wut-Rhetorik: Henning Lobin, Professor am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, beschäftigt sich seit Jahren mit der Sprache der Politik. Seine These: Die politische Auseinandersetzung wird fast nur noch von Emotionen dominiert. Und die Emotion, die am meisten bringt, ist: Wut. "Wut ist ein wunderbares Instrument, um Menschen zusammenzuführen. Und wenn erst mal eine solche Gruppenbildung stattgefunden hat, dann kann man sich viel leichter davor stellen und eine Fahne schwenken." (Tagesschau)
Mad-Man Taktik: Eine Taktik, die schon Richard Nixon beherrschte und die man auch von Putin kennt. „Mach dich so unberechenbar, dass dein Gegenüber dir alles zutraut. Donald Trump perfektioniert die Theorie des verrückten Mannes,“ sagt Bertram Kawlath, neuer Präsident des VDMA. „Der potenzielle Gewinner eines Konfliktes ist meist der, von dem die andere Seite denkt, er sei verrückt. (Herfried Münkler)
Idiocracy – Idiotenherrschaft: Dies ist mehr als nur die Machtergreifung der Dummköpfe. Der Dummkopf lebt in den rationalen Strukturen der Welt, auch wenn er sie kaum versteht. Der Idiot hingegen leugnet sie. Schlimmer noch, sie sind ihm egal. Oder noch schlimmer: sie existieren für ihn einfach nicht. Der Idiot kennt nur sich selbst. Den ganzen Rest gibt es nur, soweit er ihn auf sich selbst beziehen kann. Zu lesen bei Alex Hacke, der aus dem Buch von Zoran Terzićs Idiocracy – Denken und Handeln im Zeitalter des Idioten zitiert. Der Idiot, schreibt Terzić, »leitet seine Kompetenz wie bei einem scholastischen Gottesbeweis nur aus der Tatsache des Selbstseins ab«. (Axel Hacke im SZ Magazin März 2025). Sehenswert dazu auch der Film Idiocracy des US-amerikanischen Regisseurs Mike Judge aus dem Jahr 2006. Der Film zeigt eine Dystopie der Welt des Jahres 2505 (ups, fast hätte ich 2025 geschrieben), in der eine geistig degenerierte Gesellschaft vor ihrem Ende steht (Wikipedia)
Babylon Syndrom: „Wir haben es nicht mit einer polarisierten Gesellschaft zu tun, sondern mit einer pluralen, mit einer sehr pluralen.“ (Sinus). Wir können uns nicht mehr auf eine gemeinsame Basis, auf eine gemeinsame Wahrheit einigen. Jeder vertritt seine eigene Meinung. Vielleicht haben wir ähnliche Ziele, aber alle senden – und reden aneinander vorbei. Wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. An dieser fehlenden kommunikativen Einheit scheiterte der Turmbau zu Babylon zerbrochen, so Trendforscher Matthias Horx.
Grand Strategy - die übergeordnete Erzählung eines Staates: ein langfristiger Masterplan, der militärische, diplomatische, wirtschaftliche und ideelle Mittel zu einem strategischen Gesamtbild vereint. Die Grand Strategy geht weit über kurzfristige, nationale Taktiken hinaus: Es geht nicht nur um das Gewinnen von Konflikten, sondern um das Gestalten von Ordnungen, das Etablieren von Einflussräumen und das Sichern nationaler Interessen über Jahrzehnte hinweg. Dazu gehören Entscheidungen über Allianzen, Wirtschaftsbeziehungen, militärische Strukturen und technologische Souveränität – ebenso wie der bewusste Umgang mit Ressourcen, Ausrichtungen in der Außenpolitik und die Positionierung im globalen Machtgefüge. Für Unternehmenssprecher bietet die Grand Strategy eine interessante Analogie: Wie in der Markenführung geht es darum, kohärente Botschaften, konsistente Handlungen und langfristige Ziele so zu verbinden, dass eine glaubwürdige, resiliente Position entsteht – ob auf dem Weltmarkt oder in der Weltpolitik.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die These des Philosophen und Literaturtheoretiker Jean-François Lyotard, der die Narrative und Metadiskurse der Moderne, die vielen Ideologien zugrunde liegen, untersucht hat, wie beispielsweise die großen Erzählungen der Aufklärung, der Demokratie und des Marxismus. Hayden White (geb. 1928), ein amerikanischer Historiker, geht davon aus, dass es vier westliche Meistererzählungen gibt: griechischer Fatalismus, christlicher Erlösungsgedanke, bürgerlicher Progressivismus und marxistischer Utopismus. Lyotard vertritt jedoch die Auffassung, dass solche universalisierenden Erzählungen in der Postmoderne nicht mehr tragfähig sind und kündigte die Entstehung von „kleinen Erzählungen“ (oder Mikronarrativen, petits récits) an: lokalisierte Darstellungen begrenzter Bereiche, von denen keine den Anspruch auf universellen Wahrheitsstatus erhebt. Kritiker meinen, dass dies nur eine weitere große Erzählung sein könnte, und einige haben es als eurozentrisch bezeichnet (OxfordReference). Die derzeitige Weltlage, in der jede Region, ja fast jedes Land eine eigene Narration für sich in Anspruch nimmt, gibt Lyotard in gewisser Weise recht.
Postmoderne [post = lat.: nach] Allg.: Unklare Sammelbezeichnung für eine Geisteshaltung (neuer Zeitgeist) bzw. eine (aus Architektur und Kunst vermittelte Stil- und) Denkrichtung, die sich als Gegen- oder Ablösungsbewegung zur Moderne versteht. Der auf rationale Durchdringung und Ordnung gerichteten Moderne stellt die P. eine prinzipielle Offenheit, Vielfalt und Suche nach Neuem entgegen, die von ihren Gegnern als Beliebigkeit (»anything goes«) kritisiert wird. Pol.: Sofern die P. auch als politische Haltung bezeichnet werden kann, steht sie den politischen Institutionen und Prozessen eher kritisch, übergreifenden Bekenntnissen und Ideologien eher ablehnend gegenüber. Ablehnung und Gleichgültigkeit (z. B. auch gegenüber Wahlen) werden von Kritikern oft als fehlendes Engagement und Flucht in die Unverbindlichkeit verkannt. Dem steht ein ausgeprägtes, eher individualistisches Interessen an politisch-inhaltlichen Fragen (z. B. im Umwelt- und Gesundheitsschutz) gegenüber, d. h. die (politische) P. kann als Kritik an den (Fortschritts- und Machbarkeits-)Versprechungen der Moderne interpretiert werden (kurz-knapp)
„Denken ohne Geländer“ (Hannah Arendt): Polarisierung ist populär. Denn sie dient einem guten Zweck, sie teilt in klar definierte Lager: „Lagerbildung dient der Sicherheit und der Identifikation, Lagerbildung gibt Halt und Kontrolle. Das Denken ohne Geländer, wie Hannah Arendt es nennt, das kann man sich nur aus der inneren Freiheit heraus erlauben. Damit ist auch die Freiheit von Angst gemeint.“ (Psychiaterin Katharina Domschke im Interview 8.3.2025). Als der US-Vize J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz versuchte, Europa zu diskreditieren und das Recht auf Meinungsfreiheit einklagte, meinte er definitiv nicht ein „Denken ohne Geländer“ (Über die Vereinnahmung und Umdeutung des Begriffes „Meinungsfreiheit“).
Gesetz der Selbstverdummung von Autokratie: Demokratien haben eine entscheidende Schwäche, sie arbeiten langsamer als Autokratien. In der Demokratie benötigt man Beratungszeit, Zeit, Meinungen auszutauschen, zu verhandeln und Kompromisse zu finden. Am langsamsten sind dabei parlamentarische Demokratien wie die deutsche. Etwas flotter geht es in Präsidialdemokratien als in Frankreich. Umgekehrt jedoch wird das Fehlen an Beratschlagung und Kompromissfindung – langfristig – zur entscheidenden Schwachstelle für Autokratien. „Je länger der Autokrat an der Macht ist, desto misstrauischer wird er gegenüber Leuten, die ihm Hinweise geben, die ihm nicht passen“ (Herfried Münkler). Desto mehr droht die Verdummung – ein Lichtblick für die Demokratie.
Negative Partisanship – negative Parteilichkeit: Das Phänomen, dass eine Wahlentscheidung nicht gefällt wird, um einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu unterstützen, sondern um einen Kandidaten zu verhindern – der US-Politikwissenschaftler Alan Abramowitz prägte erstmals den Begriff. Die Sozialforscher Hall und Sam Whitt beobachten, dass Wähler ohne politische Heimat, zunehmend beide Seiten des politischen Spektrums verabscheuen. Die Gegenseite zu bestrafen, ist damit für sie wichtiger, als eigene Leute zu belohnen. Und der niederländische Autor Rutger Bregmann sagt, dass selbst Leute, die sich als progressiv bezeichnen, heute hauptsächlich wüssten, wogegen sie seien, aber nicht wofür: „Aber wir müssen auch wissen, wofür wir sind. Martin Luther King hat nie gesagt: `Ich habe einen Albtraum´“ (zitiert Axel Hacke im SZ-Magazin).
Competitive Victimhood - Phänomen der Opferkonkurrenz: Betroffenen – Opfern – muss man zuhören. Betroffene dürfen nicht kritisiert oder gar infrage gestellt werden. Überdies sollen bitte alle schweigen, die nicht betroffen sind. Denn wer nicht betroffen ist, gilt als privilegiert. Anstatt sich also stark, erfolgreich und überlegen zu präsentieren, zeigt man sich als schwach und verletzlich. Kommunikationswissenschaftler konnten zeigen, dass Menschen, die sich mit ihren Schwächen zeigen, automatisch als tugendhafter wahrgenommen werden als aktiv handelnde, erfolgreiche Menschen. Die Position des Opfers beschert – vorwiegend in Social Media – Aufmerksamkeit, schafft Mitgefühl und lässt sich auch als Instrument nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen (zumindest Likes und Follower) (absolut lesenswert: Was uns stark macht von Sebastian Herrmann, SZ 14.12.2024)
Petra Sammer zählt zu den Pionieren des Storytellings in Unternehmen. Sie etablierte deren Einsatz, insbesondere im deutschsprachigen Raum, und prägt bis heute die Branche als führende Expertin für strategisches Erzählen in PR und Marketing – durch ihre Vorträge, ihre Beratungstätigkeit und ihre Fachpublikationen, die als Standardwerke gelten.
Aktuell: What´s your Story - Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen. Ein Buch von Petra Sammer, dpunkt Verlag. ISBN Print: 978-3-96009-083-0ISBN Bundle: 978-3-96010-561-9ISBN PDF: 978-3-96010-321-9ISBN ePub: 978-3-96010-322-6ISBN Mobi: 978-3-96010-323-3