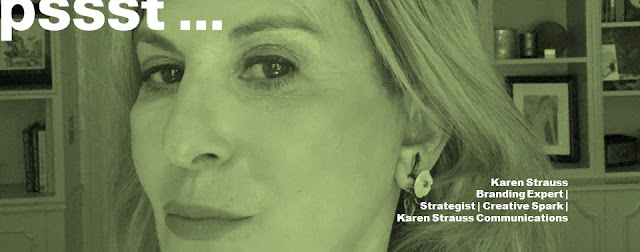Schau mir in die Augen, Kleines
Der Mensch ist ein Augentier. Sagt man. Doch könnten Tiere sprechen, einige würden hier Protest einlegen. Bienen, Vögel und viele Fische zum Beispiel sehen in Bereichen, von denen wir nicht einmal eine Vorstellung haben: Sie können ultraviolettes Licht wahrnehmen. Fliegen und Libellen sehen mit ihren Komplex- und Facettenaugen wesentlich schneller als wir. Sie registrieren bis zu 300 Bilder pro Sekunde, fünf Mal mehr als Menschen, die gerade mal 50 bis 65 Bilder pro Sekunde schaffen.
Fliegen kommt daher ein YouTube-Video ruckelnd wie eine veraltete Diashow vor. Kein Wunder, denn ihr Auge setzt sich aus bis zu 30.000 winzigen Einzelaugen zusammen. Greifvögel sehen extrem scharf. Ihre Augen besitzen bis zu sieben Mal mehr lichtempfindliche Zellen als Menschen. Das »Adlerauge« ist auch überproportional groß im Verhältnis zum Kopf, daher sehen Adler wesentlich weiter.
Wunder der Evolution
Das Auge ist ein Produkt der Evolution. Der schwedische Zoologe Dan-Erik Nilsson wies in den 90er Jahren nach, dass 2.000 Entwicklungsschritte notwendig sind, um aus einer einfachen Lichtsinneszelle das Linsenauge eines Wirbeltieres zu entwickeln. Etwa 360.000 Generationen sind für diese Entwicklung nötig. Wir hatten vier Milliarden Jahre Zeit, um zu dem zu werden, was wir sind, denn seit dieser Zeit ist Leben auf unserem Planeten belegt. Anhand fossiler Funde wissen wir, dass innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre alle bekannten Augentypen entstanden sind – vom Grubenauge über das Lochauge bis hin zu höher entwickelten Formen wie dem Linsen- oder Komplexauge.Die ersten Mehrzeller hatten nur einfache Lichtsinneszellen, doch schon Quallen haben eine zusammenhängende Ansammlung von Photorezeptoren, sogenannte Flachaugen. Beim Nautilus, einem Verwandten des Tintenfisches, findet sich schon ein Vorläufer des Linsenauges. Sein Auge besteht aus einer Gewebegrube mit einem kleinen Loch in der Mitte, durch das Licht einfallen kann. Ähnlich wie bei einer Lochkamera können hier Bilder entstehen.
Doch so geradlinig, wie es den Anschein hat, verlief die Entwicklung nicht. Der Evolutionsbiologe Ernst Mayr und der Wiener Zoologe Luitfried Salvini-Plawen verwiesen 1977 darauf, dass es wohl über 40 Überarbeitungen des Auges durch die Evolution gegeben hat, und entsprechend viele unterschiedliche Augentypen gibt es. Der Grund für all diese Anstrengungen? Überleben. Sehen entscheidet über Leben und Tod, über Fressen oder Gefressen-Werden. Wer besser sehen kann, setzt sich durch. In punkto Sehen sind wir Menschen im Vergleich zu manchen Tieren vielleicht nicht die Besten, aber insgesamt doch ganz passabel.
Augenscheinlich…Was ist Sehen?
In seiner Schrift »Über die Seele« beschreibt Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) die menschlichen fünf Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Die Reihenfolge, in der Aristoteles diese fünf Sinne auflistet, sagt einiges über die Bedeutung des Sehens aus: 80 Prozent der Informationen, die wir aufnehmen, stammen aus visueller Wahrnehmung. Der Sehsinn ist der wichtigste Sinn, mit dem wir uns die Welt erschließen.Sprachwissenschaftlich betrachtet, leitet sich das Wort »sehen« aus der indogermanische Wurzel »sekw« ab, was so viel wie »bemerken, sehen; mit den Augen verfolgen« hieß. Auch gibt es eine Verwandtschaft zu dem lateinischen Verb »sequi«, das »folgen« heißt. Wir »folgen« den Bildern, die wir wahrnehmen, und machen uns dadurch ein Bild von der Welt. Allgemein definiert man Sehen als »die Fähigkeit, Lichtreize aufzunehmen und die in ihnen enthaltenen Informationen über die Umwelt zu erkennen und zu verstehen«. Doch was genau passiert, wenn Lichtreize in unser Auge fallen?
Bauanleitung für Ihr Auge
Um ein gutes Auge zu bauen, benötigen Sie etwas Hornhaut, eine Iris, eine Pupille und eine Linse, einen Glaskörper sowie eine Netzhaut mit jeder Menge Photorezeptoren, bekannt als Zapfen und Stäbchen – genau genommen 125 Millionen. Darüber hinaus sind noch eine Million Nervenfortsätze für den Sehnerv erforderlich, der die Verbindung zum primären visuellen Cortex und den visuellen Assoziationscortices bildet, den Regionen im Gehirn, die Lichtinformationen weiterverarbeiten.Der Bauplan eines Auges ist also schnell erstellt, doch lange Zeit war sich die Wissenschaft uneinig, wie der Mechanismus des Sehens tatsächlich funktioniert. Die griechischen Philosophen Demokrit (460 bis 371 v. Chr.) und Epikur (341 bis 270 v. Chr.) glaubten zum Beispiel, dass jeder Gegenstand ein farbiges Abbild auslöse, ein sogenanntes Eidolon, das durch die Luft fliegt und dann ins Auge wandert, wo unsere Seele es erkennt. Platon (428 bis 348 v. Chr.) behauptete, dass das Auge Sehstrahlen und Licht aussende und die Welt absuche. Erst Aristoteles (394 bis 322 v. Chr.) kam dem Rätsel näher, denn er beschäftigte sich nicht nur mit dem Auge, sondern vor allem mit dem Phänomen Licht. Einige seiner Kernaussagen zum Licht haben bis heute Gültigkeit und begründeten die Wissenschaft der Optik:
- Licht ist immateriell.
- Licht wird von Gegenständen reflektiert, und wenn das reflektierte
- Licht das Auge trifft, findet Sehen statt.
- Das Medium, durch das Licht wandert, ist unsichtbar.
Das Wunder des Sehens
Es sollte jedoch weitere 1000 Jahre dauern, bis es einem arabischen Gelehrten gelang, das Wunder des Sehens zu entschlüsseln. Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haitham, den europäische Historiker später »Alhazen « nannten (ca. 965 bis 1039 n. Chr.), interessierte sich für Naturwissenschaften, was ihm ein hohes Ansehen und eine Karriere als Beamter in Bagdad ermöglichte. Seine wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten sprachen sich schnell herum, und so wurde er vom Kalifen al-Hakim für eine ganz besondere Aufgabe an den Hof gerufen: die Regulierung des Nils. Alhazen beeindruckte den Kalifen mit seinem Wissen, der ihn bald darauf zum Wesir ernannte.Doch mit dem Aufstieg am Hofe wurde der Wissenschaftler leider auch immer häufiger mit den Machtspielen und politischen Komplotten des Kalifen konfrontiert. Alhazen, der weder an Macht noch an Karriere interessiert war, wollte sich daher aus der Position zurückziehen und sich stattdessen ganz dem Studium der Wissenschaften widmen. Um seinen Dienstherrn nicht zu verärgern, wandte er eine List an: Er täuschte einen Nervenzusammenbruch vor und gab vor, geisteskrank zu sein – mit Erfolg, denn 1011 entband al-Hakim ihn von seinen Pflichten und stellte ihn unter Arrest.
Als der Kalif zehn Jahre später verstarb, »gesundete« Alhazen unverzüglich. Die Zeit des Arrestes hatte er für das Studium des Sehens genutzt. Alhazens »Buch der Optik« gilt bis heute als eines der bedeutendsten Werke der Physik und der Medizin, denn es beschreibt erstmals den anatomischen Aufbau des Auges, zeigt die Bedeutung der Linse und widerlegt damit die antike Sehstrahl Theorie Platons.
Der Wissenschaftler aus Basra beschreibt die optischen Gesetze, erläutert die Grundprinzipien der Lichtreflexion und geht sogar auf die neuropsychologischen Aspekte der visuellen Wahrnehmung ein. Alhazen betont, dass Sehen weniger im Auge als vielmehr im Gehirn stattfindet und Sehen stark von den persönlichen Erfahrungen eines Menschen abhänge. Wie er Recht behalten sollte! Mithilfe von Kerzen baute er in einem abgedunkelten Raum und mit einer durchlöcherten Zwischenwand erstmals eine »Camera obscura«, den Vorläufer der Fotokamera, führte zahlreiche Versuche mit Linsen durch und leistete entscheidende Vorarbeit für die Erfindung der Brille.
So umfangreich Alhazens Studien auch waren, es blieben einige wichtige Fragen offen: Wie zum Beispiel können Bilder durch ein Loch »wandern« (»Camera-obscura-Effekt«)? Und warum stehen diese projizierten Bilder auf dem Kopf? Dieses Phänomen, mit dem auch unser Auge arbeitet, erklärte 600 Jahre später der Astronom Friedrich Johannes Kepler (1571 bis 1630 n. Chr.). Der religiöse Kepler wollte eigentlich beweisen, dass Gott über das Auge mit uns Menschen in Verbindung steht. Er entdeckte jedoch die Tatsache, dass Licht aus Wellen besteht, und dass diese Wellen auf die Augenlinse treffen, von der sie gebündelt und gebrochen werden, damit auf der Netzhaut ein kleines, umgekehrtes Abbild entsteht.
Seine Enttäuschung war jedoch groß, dass er weder einen Gottesbeweis finden, noch erklären konnte, wie das Gehirn mit dem auf dem Kopf stehenden Bild auf der Netzhaut weiter arbeitet: »Seine Ausrüstung hilft dem Optiker nicht über diese erste unüberwindliche Mauer hinweg, der er im Auge begegnet«, so Kepler ratlos in einem seiner Briefe.
Farbe - Welle oder Teilchen?
Wie unser Gehirn mit den Lichtwellen, den daraus abgeleiteten unendlich vielen Informationen und den auf dem Kopf stehenden Abbildern umgeht, ist selbst heute noch nicht in aller Gänze ergründet. Doch eines wissen wir bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sicher: wie wir Farben sehen. Sir Isaac Newton (1642 bis 1726) konnte in Experimenten mit Glasprismen nachweisen, dass Licht selbst keine eigene Farbe hat, sondern sich aus den Spektralfarben zusammensetzt. Allerdings nahm er daher auch an, dass Licht nicht aus Wellen, sondern aus kleinsten Teilchen bestehe, die auf das Auge treffen. Thomas Young (1773 bis 1829) verfestigte wiederum die These, dass Licht aus Wellen besteht und jede Farbe einer bestimmte Wellenlänge zugeordnet werden kann: Rot hat 676 nm (Nanometer) und Violett 424 nm.Letztendlich haben beide Recht, die Verfechter der Wellentheorie und die der Teilchentheorie. Bewiesen hat dies Albert Einstein (1879 – 1955). Er löste das Rätsel des photoelektrischen Effekts, des Phänomens, dass Bestrahlung aus einer Metallplatte Elektronen herauslösen kann. Einstein wies damit physikalische Teilchen im Licht nach, die er »Lichtquanten« nannte. Für diese Entdeckung erhielt er 1921 den Nobelpreis – nicht für die Relativitätstheorie.
Um Farbe erkennen zu können, haben sich die Rezeptoren unserer Netzhaut auf unterschiedliche Wellenlängen spezialisiert. So gibt es Zapfen, die auf Blau reagieren, Rezeptoren, die Grün wahrnehmen und weitere Zapfen, die Rot registrieren. Die Stäbchen auf unserer Retina sind schließlich für die Wahrnehmung der Helligkeit der Farben zuständig.
Rot, Grün, Blau: Die drei Primärfarben in der entsprechenden Helligkeit gemischt, ergeben zusammengenommen das Farbempfinden von Weiß. Ganz ohne Licht sehen wir die drei Farben als Schwarz. Die Summe aus nur zwei Primärfarben ergibt die Sekundärfarben Gelb, Cyan oder Magenta. Primär- und Sekundärfarben sowie Schwarz plus Weiß, und fertig ist das komplette Farbspektrum, denn damit lassen sich alle Farben durch Mischen herstellen. Dieses Verfahren nennt man additive Farbmischung, und Farbfernsehen funktioniert ebenso.
Während das Erkennen von Farben hinreichend erforscht ist, gibt es darüber hinaus noch zahlreiche »blinde Flecken« in der Erklärung des Sehens. Was wir »visuelle Wahrnehmung« nennen, wurde in den letzten fünf Jahrzehnten intensiv erforscht, doch selbst heute, mit den Mitteln der modernen Neurophysiologie, tappt die Wissenschaft teilweise noch im Dunkeln. Zum Beispiel ist nicht hinlänglich erklärt, warum wir manchmal Farben oder Rotationen sehen, wo gar keine sind.
Dass uns der Sehsinn täuscht, liegt vielleicht in der Tatsache begründet, dass wir Farben nicht absolut, sondern meist in Bezug zu anderen, benachbarten Farben identifizieren. Somit kann es zu Farbfehlern kommen. Bezieht unser Gehirn hier also die Farben der Umgebung unbewusst mit ein? Bleiben Sie also auf der Hut – Ihr Sehsinn, spielt Ihnen vielleicht einen Streich.
Übrigens: Der berühmte Satz »Schau mir in die Augen, Kleines«, den Barbesitzer Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, im Film »Casablanca« (1942) zu seiner Geliebten Ilsa Lund sagt, gespielt von Ingrid Bergman … dieser Satz existiert nur in der deutschen Synchronfassung. Im englischen Original sagte Bogart: »Here’s looking at you, kid« – ein Trinkspruch, den Bogart improvisiert hatte.
Visuelle Storyteller sollten wissen, wie unser Auge funktioniert und welche Informationen wir benötigen, um die Welt tatsächlich zu „erkennen“. Mehr dazu finden Sie in dem Buch „Visual Storytelling: Visuelles Erzählen in PR und Marketing“ von Petra Sammer und Ulrike Heppel, O´Reilly – aus dem dieser Textauszug stammt.
Photo by Alex Perez on Unsplash