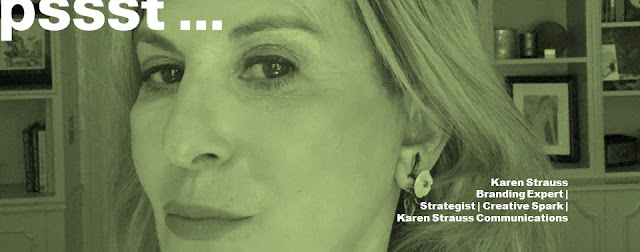Man muss nicht alles zeigen: Psychologie der visuellen Wahrnehmung

Erinnern Sie sich noch an »Dalli Klick«? In der erfolgreichen ZDF-Fernsehshow »Dalli Dalli«, die von 1971 bis 1986 von Hans Rosenthal moderiert wurde und die Kai Pflaume seit 2011 versucht, wiederzubeleben, gab es ein Spiel, das beim Fernsehpublikum besonders beliebt war: Dalli Klick. Hans Rosenthal zeigte den Kandidaten ein Foto, das zunächst von schwarzen Kacheln verdeckt war. Nach und nach wurden die Kacheln aufgedeckt. Immer mehr von dem darunterliegenden Motiv wurde sichtbar. Wer als Erster das Motiv erraten konnte, hatte gewonnen.
Die Fähigkeit, unvollständige Bilder aufzufüllen, »Filling-in« genannt, ist Teil unserer »visuellen Intelligenz«. Wir sind in der Lage, fehlende visuelle Informationen mithilfe unserer visuellen Datenbank aufzufüllen und Bilder zu komplettieren – auch wenn uns das letzte Puzzlestück fehlt.
Vorstellungskraft: Filling in
Der Werbespot einer japanischen Kinderstiftung nutzt das Phänomen des »Filling-in« auf eine berührende Art. Ein kleiner Junge zeichnet nur schwarze Kreidebilder. Seine Eltern sind verzweifelt. Lehrer, Ärzte, Psychologen können nicht erklären, warum der Kleine nur schwarz malt. Bis plötzlich alles einen Sinn ergibt ... aber sehen Sie selbst.
Jede visuelle Erfahrung aktiviert in unserem Gehirn immer wieder dieselben Photorezeptoren, die ihrerseits wieder benachbarte Ganglienzellen und rezeptive Felder ansprechen. So speichern wir visuelle Informationen und legen im Laufe unseres Lebens eine »visuelle Landkarte« an. Diese neuronale Verortung ermöglicht uns, visuelle Reize schnellstmöglich einzuordnen und zu interpretieren.
Brainstormen Sie doch mal mithilfe der kognitiven Landkarte. Dabei visualisieren Sie eine Aufgabenstellung in Form einer Landkarte. Diese visuelle Brainstorming-Technik hilft Ihnen dabei, Probleme und Aufgabenstellung symbolisch zu zeichnen. Skizzieren Sie Daten, Fakten und Themen sowie Hürden und Herausforderungen Ihrer Aufgabe als »Länder«, »Inseln«, »Berge« oder »Täler«. Zeichnen Sie in verschiedenen Größen und Farben, zeigen Sie räumliche Anordnungen und Verbindungswege auf und gewinnen Sie mit dieser Kreativmethode eine andere Perspektive auf Ihre Aufgabe.
Visuelle Landkarten: Wie wir Lücken füllen
Wie stark verankert diese »gelernten« Bilder sind, erläutert der Psychologe Karl R. Gegenfurter von der Justus Liebig-Universität in Gießen: »Betreten wir einen uns bekannten Raum, so haben wir in kürzester Zeit den Eindruck, ihn vollständig erfasst zu haben. Das visuelle Gedächtnis hilft uns, schon aus wenigen Sinnesdaten eine vollständige Gestalt zu rekonstruieren, indem die Lücken mit schon gespeicherten Inhalten aufgefüllt werden. Die Rekonstruktion des Gesamtbildes aus wenigen Eckdaten kann jedoch auch zu Fehlleistungen führen. So kann es beispielsweise geschehen, dass selbst größere Veränderungen in einer Gesamtszene nicht oder erst nach längerer, genauerer Analyse wahrgenommen werden. Dieses Phänomen wird als »change blindness« bezeichnet. Das rekonstruierte Bild der Umwelt beruht zu einem großen Teil auf Annahmen über die Beschaffenheit dieser Umwelt. Nur ein bestimmter Ausschnitt dieser Umwelt ist tatsächlich in unserem visuellen System repräsentiert.«Das lässt tief blicken: Unser Weltbild
Sehen ist also weit mehr als ein plumper Reiz-Reaktionsmechanismus. Es ist ein Konstruktionsprozess, mit dem wir die Welt nicht nur registrieren, sondern sie auch erschließen und erklären. Das ist es, was der Philosoph Martin Heidegger (1889 bis 1976) treffend »Weltbild« nennt. Heidegger weist damit auf die laufenden Sinnzusammenhänge hin, die wir in alles, was wir sehen, hineininterpretieren und die wir bildübergreifend konstruieren. Psychologen gehen in der Deutung des Sehens sogar noch einen Schritt weiter. Das Sehen und die Reflexion darüber machen sie maßgeblich verantwortlich für unsere Eigenwahrnehmung und unser Selbstbewusstsein. Wir nehmen uns selbst durch Sehen wahr, sei es über unser Spiegelbild, über ein Selbstporträt ... oder eben über ein Selfie.Wichtig zu wissen ist dabei, dass wir bei der Verarbeitung von visuellen Reizen kaum einen Unterschied machen zwischen der Realität und der Abbildung der Realität. Mental reagiert unsere Psyche auf Bilder, Fotografien und Filme sehr ähnlich – als seien sie real. Der neuronale Scan einer Person, die eine erschreckende oder lustige Szene auf einem Foto sieht, unterscheidet sich kaum von dem Gehirnscan einer Person, die tatsächlich Zeugin dieser Szene ist. Die gleichen Gehirnregionen werden aktiviert und »leuchten« im Scan auf. Erst zusätzliche Sinneseindrücke wie Hören, Fühlen, Riechen oder Schmecken verdichten die Wahrnehmung in der Realität.
Text versus Bild
Große Unterschiede in unserer emotionalen Reaktion gibt es jedoch, wenn wir Text mit Bild vergleichen. Dazu folgt hier eine Übung. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das folgende Wort lesen? Welche Reaktion löst das Wort bei Ihnen aus?
KATZE
Und was empfinden Sie, wenn Sie das folgende Bild sehen? Welche Gefühle löst das Bild bei Ihnen aus?
Visuelle Reize speichern Erfahrungen und die damit gemachten Emotionen (zum Beispiel das Streicheln einer Katze). Bilder können diese Emotionen wecken und aus dem visuellen Gedächtnis wieder abrufen. Genau das ist es, was visuelles Storytelling so interessant macht – besonders in der professionellen Kommunikation. Wir sind mit Bildern in der Lage, gezielt Emotionen auszulösen.
Mehr Infos, Hintergrundwissen und Beispiel zum Thema „Visuelles Erzählen“ finden Sie in dem Buch „Visual Storytelling: Visuelles Erzählen in PR und Marketing“ von Petra Sammer und Ulrike Heppel, O´Reilly – aus dem dieser Textauszug stammt.
Photos by Christopher Paul High and Tran Mau Tri Tam on Unsplash