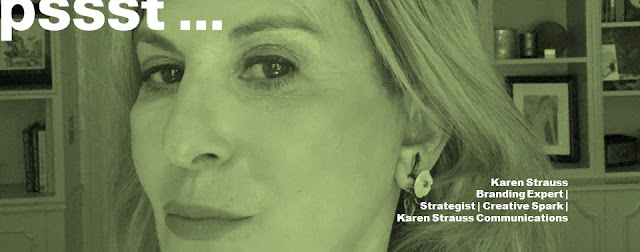Farbe ist keine Selbstverständlichkeit - für visuelle Storyteller
»Im Alter von elf wurde mir erstmals klar, dass ich die Welt anders sah als die meisten Menschen. Ein Schock. Ich war bis dahin fest davon überzeugt, dass Farben ausschließlich aus Schwarz, Weiß und Abstufungen von Grau bestehen würden. Schließlich sind dies die Farben, in denen ich die Welt seit meiner Geburt sehe.« Neil Harbisson
1993 stellen die Ärzte bei Neil Harbisson fest, dass er an Achromatopsie leidet, einer seltenen Form von Farbenblindheit, die nur einmal unter 33.000 Menschen vorkommt. In der Netzhaut des menschlichen Auges sind Farbrezeptoren, die Zapfen, dafür verantwortlich, dass man Farben erkennen kann. Neils Zapfen sind jedoch aufgrund einer genetischen Störung defekt und so mussten die Ärzte dem katalanischen Jungen mitteilen, dass seine Krankheit unheilbar sei. Neil würde sein Leben lang keine Farben erkennen können.
Doch es sollte anders kommen. Der Junge ließ sich von seiner Behinderung nicht unterkriegen und beschloss, Kunst zu studieren. Dabei interessierte sich Neil besonders für Musik. Das Klavier war sein Lieblingsinstrument, schon wegen der Farben der Tasten. Aber auch die Malerei faszinierte ihn, denn er wollte so viel wie möglich über Farben erfahren.
Seine Bewerbung am Institut Alexander Satores in der Nähe von Barcelona wurde angenommen und er überzeugte seinen Lehrer, alle visuellen Arbeiten in Schwarz-Weiß zu erstellen.
»Ich war ein selbstbewusster junger Mann, der versuchte, mit seiner Behinderung aktiv umzugehen. Doch es ist nicht leicht, ein Leben ohne Farben zu meistern. Besonders die ganz einfachen, alltäglichen Dinge bereiteten mir Schwierigkeiten. Frühstücken zum Beispiel. Wenn Lebensmittel nicht in ihrer ursprünglichen Form auf den Teller kamen, konnte ich sie nicht erkennen. Und immer wieder verwechselte ich Orangensaft mit Apfelsaft oder auch Tomatensauce. Immer wieder musste ich fragen, um welches Lebensmittel es sich handle, oder versuchen, Essen anhand seines Geruchs zu erkennen. In der Schule hielten mich viele Mitschüler für faul, weil ich sie immer wieder nach dem roten oder blauen Stift fragte. Dabei konnte ich einfach nicht den Unterschied sehen. Und später an der Uni kleidete ich mich ausschließlich in schwarz. Einerseits, weil es als intellektuell galt, andererseits, weil ich einfach keinen Sinn darin sah, Klamotten in unterschiedlichen Grautönen zu tragen, denn das waren die einzigen ›Farben‹, die ich sehen konnte.«
Videotipp: Valspar, Wandfarben, gewann 2016 mit der Kampagne „Color for the Color Blind“ einen Cannes Gold Lion in der Kategorie „Health“. Wunderbar anzusehen.
Farben hören
2001 wechselte Harbisson an das Dartington College of Arts im Südwesten von England, wo er begann, experimentelle Komposition zu studieren. Und wo er demjenigen Menschen begegnen sollte, der sein Leben verändern würde – der Farbe in sein Leben bringen würde.Adam Montandon, Absolvent der Universität von Plymouth, hielt am Dartington College eine Vorlesung über Kybernetik. Besonders seine Kenntnisse zur akustischen Regelsteuerung weckten Neil Harbissons Interesse:
»Nach der Vorlesung ging ich auf Adam zu und fragte ihn, ob wir nicht etwas zusammen entwickeln könnten, damit ich Farben sehen könne. Er willigte ein und kam zurück mit einem simplen Gerät, bestehend aus einer Webcam, einem Kopfhörer, einem Computer, den ich mir auf den Rücken schnallte, und einer Software, die Farben in Töne umwandelte.«
Nach 21 Jahren, in denen Neil Harbisson ausschließlich Schwarz und Weiß unterscheiden konnte, eröffnete sich für ihn plötzlich die Welt der Farben. Das Gerät, das Montandon und Harbisson »Eyeborg« nannten, ermöglichte Neil ab 2003, die Welt »bunt« in Tönen zu hören. Dafür wandelt die Kamera, die Neil vor der Stirn trägt, Farben in Schallwellen um, die dann per Kopfhörer in Neils Ohr übertragen werden.
Jede Farbe hat eine eigene Tonfrequenz: Die dunkelsten Farben des Farbspektrums wie Dunkelrot haben die tiefsten Frequenzen, die höchsten Farben wie etwa Violett haben die höchsten Frequenzen. Es dauerte eine Weile, sich an diese neue Art des »Sehens« zu gewöhnen, aber da Neil den Eyeborg konstant trug, lernte er bereits nach fünf Wochen, sich auf die neue Sichtweise ein- und umzustellen.
»Am Anfang musste ich mir (...) die Namen merken, die ihr jeder Farbe gebt, d. h., ich musste mir die Töne einprägen. Aber schließlich wurden sämtliche Informationen zu einer Wahrnehmung. Ich dachte nicht über die Töne nach. Und nach einer Weile wurde diese Wahrnehmung zu einem Gefühl. Ich begann, Lieblingsfarben zu haben, und in Farben zu träumen.«
Neil Harbisson »sieht« heute 360 Farben, etwa so viele wie jeder Mensch: »Das Leben hat sich dramatisch verändert, seit ich Farben höre. Denn Farben gibt es fast überall. Die größte Veränderung ist zum Beispiel, dass ich einen Picasso hören kann, wenn ich ein Museum besuche. Es ist, als würde ich in ein Konzerthaus gehen, weil ich den Bildern zuhören kann. Und Supermärkte – das ist sehr schockierend –, es ist sehr reizvoll, durch einen Supermarkt zu gehen. Wie in einem Nachtclub: Er ist voller unterschiedlicher Melodien. Ja. Besonders der Gang mit den Reinigungsmitteln. Das ist einfach großartig. Auch die Art, wie ich mich kleide, hat sich verändert. Früher habe ich mich so angezogen, dass es gut aussah. Heute ziehe ich mich so an, dass es sich gut anhört.«
Seine Fähigkeit, Sinneseindrücke von Sehen zu Hören und umgekehrt zu übersetzen, nutzt Harbisson heute in seiner künstlerischen Arbeit. Mit bizarren Tonfolgen macht er die Meisterwerke der Malerei für sein Publikum hörbar. Umgekehrt malt er die Töne berühmter Reden wie etwa Martin Luther Kings Rede »I have a dream« als farbenfrohe Bilder.
Videotipp: Mercedes-Benz spielte 2010 in dem Spot »Hören Sie den Sommer« mit den beiden Sinnen Hören und Sehen, um Lust auf die Cabriolets der Marke zu machen. Hören und sehen Sie selbst
Die Welt erkennen – durch Farbe
Neil Harbisson, der Farbenblinde, führt uns vor Augen, wie intensiv unsere Welt von Farben geprägt ist und, noch viel grundsätzlicher, wie entscheidend das Visuelle für uns Menschen ist. Denn wir sehen die Welt nicht einfach mit unseren Augen, sondern unser Sehsinn hilft uns in einem umfassenderen Sinn, die Welt zu erkennen und zu verstehen.Wer sich auf die Kunst des visuellen Storytellings einlassen möchte, sollte sich mit der Mechanik des Sehens beschäftigen, mit der Art und Weise, wie unsere Augen funktionieren und wie unser Gehirn die pure visuelle Information sinnvoll umwandelt. Dieser Meinung ist auch Uwe Stoklossa, der sich in seiner Dissertation mit dem Titel »Ich sehe nichts, was du nicht siehst« mit den Bildertricks der Werbung auseinandersetzt:
»Man muss nicht wissen, welche chemischen Reaktionen sich auf den Stäbchen und Zapfen der Netzhaut abspielen, um ein gutes Plakat zu gestalten. Aber viele der Erkenntnisse, zum Beispiel aus dem Bereich der Wahrnehmungspsychologie, lassen sich im Grund eins zu eins auf die tägliche Arbeit eines Grafikers übertragen und sind sehr nützlich bei der immer wieder neuen alten Frage: ›Wie kann ich mein Thema oder Produkt mal aus einer anderen Perspektive oder einem anderen Blickwinkel präsentieren?‹«
Übrigens: Neil Harbisson erweiterte sein Farbspektrum auch auf Infrarot und Ultraviolett. Der einst Benachteiligte hat die Technik, die seine Behinderung ausgleichen sollte, optimiert und seine Fähigkeiten des »Sehens« über die eines normalen Menschen hinaus ausgeweitet. Diese Optimierung und auch die Tatsache, dass sich Neil Harbisson seinen Eyeborg – den Computer, der Farben in Töne umwandelt – in den Hinterkopf implantieren ließ, sind die Gründe dafür, dass sich Harbisson heute als »Cyborg« bezeichnet und 2010 die Cyborg-Stiftung gründete.
Textauszug aus dem Buch „Visual Storytelling: Visuelles Erzählen in PR und Marketing“ von Petra Sammer und Ulrike Heppel, O´Reilly.
Photo by Mike Dorner on Unsplash