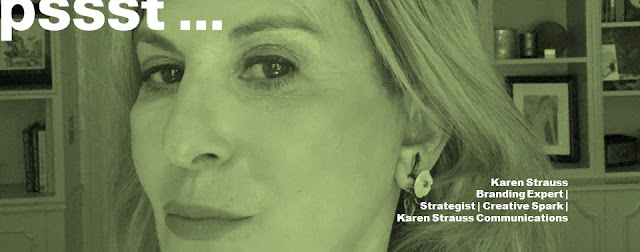Über die Kunst, Unsichtbares sichtbar zu machen - mit Storytelling
»Although the mind may be part of your target, the heart is the bull’s-eye.« – Peter GruberWer Plattencover für die Rolling Stones, Talking Heads, Loo Reed, David Byrne, Aerosmith oder Pat Metheny gestaltet, muss zweifellos ein viel beschäftigter Designer sein. Und in der Tat kann sich Stefan Sagmeister nicht beklagen über zu wenig Aufträge. Das ist auch der Grund dafür, dass der Gründer der Grafikagentur Sagmeister Inc. – heute Sagmeister & Walsh – Anfang 2000 auf seinen Anrufbeantworter »Call us in a year« spricht und sich ein Jahr Auszeit gönnt. Bald wird das Sabbatical allerdings zum Desaster. Denn der Wunsch, endlich planlos den Tag zu verbringen und sein Leben zu genießen, empfindet der Workaholic schon nach kurzer Zeit als mentale Folter. Sagmeister macht daher das, was er immer macht: eine Liste. Eine Liste aller Dinge, vor allem aber Tätigkeiten, die er liebt und von denen er glaubt, dass sie ihn glücklich machen.
Eine Liste zum Glücklichsein?
Doch ist eine Liste tatsächlich das Rezept zum Glücklichsein? Sagmeister will es herausbekommen und findet damit gleichzeitig das Thema seines Lebens und seiner zukünftigen Arbeit: Design und Happiness. Hoch motiviert stürzt sich der gebürtige Österreicher in die Suche und überlässt dabei nichts dem Zufall. Der Grafikdesigner holt sich mit Jonathan Haidt professionelle Hilfe, denn der Psychologe und Glücksforscher erarbeitet mit Sagmeister einen systematischen Plan für dessen Glückssuche. Die beiden einigen sich auf drei Methoden, die Sagmeister jeweils drei Monate lang zur Glücksfindung ausprobieren soll: Meditation, Verhaltenstherapie und Drogen (Psychopharmaka).
Das gesamte Experiment hält der Designer in einem Film fest, dessen Namen schnell gefunden ist: »The Happy Film«. Sieben Jahre lang wird Sagmeister am »Happy Film« arbeiten. Er wird mit dieser Arbeit den Tod seiner Mutter, den Bruch dreier Beziehungen und auch den Krebstod seines Filmregisseurs und Freundes Hillman Curtis verarbeiten. Er wird das Rezept zum Glücklichsein finden. Er selbst allerdings wird nach Beendigung des Films nicht wesentlich glücklicher sein.
Dem Glück auf der Spur – mit allen Sinnen
Glück – welches Thema kann emotionaler sein? Stefan Sagmeister erzählt seine Geschichte von der Glückssuche in zahlreichen Vorträgen und Präsentationen. Dabei steht er vor der Schwierigkeit, etwas zu erzählen, was man nicht sehen kann. Nicht greifen, nicht fühlen, riechen oder schmecken. Oder etwa doch?
Wie man vom Glück erzählt, ist nicht nur ein Problem für Sagmeisters Vorträge. Auch der »Happy Film« muss etwas sichtbar und sinnlich greifbar machen, das selbst für den Verstand schwer begreifbar ist. Um diese Aufgabe zu lösen, verlässt sich Sagmeister auf seine Fähigkeiten als Designer. Denn die Instrumente, denen sich ein Grafikdesigner bedient, sind mächtige emotionale Trigger: Wort und Bild. Worte, die wie Bilder gesetzt werden, sind Kino im Kopf. Sprechende Bilder sind zentrale Elemente einer Rede, wichtige Informationsträger und weit mehr als nur schmückende Dekoration. Wer Wort und Bild kreativ und sinnlich und gleichberechtigt nebeneinander einzusetzen weiß, der schöpft das volle Potenzial des visuellen Storytellings aus – und Stefan Sagmeister ist ein Meister darin.
Auf der Suche nach dem Glück lässt er Eier vor Freude platzen, lässt Wasserbomben über seinem Kopf ergießen, Milch- und Kaffeebecher überquellen, Wackelpuddings hüpfen, Affen mit Bananen Scrabble spielen und Gänse Buchstaben fressen. Sagmeister lässt balinesische Tempeltänzerinnen Zitate tanzen und bringt Bäume zum Sprechen. Seine Geschichten vom Glück handeln von Sehnsucht und Frust beim Meditieren auf Bali, von Lebensbeichte und Selbsterkennung unter den strengen Augen einer New Yorker Psychotherapeutin und von Selbstbetrug und Neurose während der Einnahme von Aufputschmitteln trotz ärztlicher Aufsicht.
Über Glück reden oder Glück zeigen
Sagmeister nimmt sein Publikum dabei mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Sein Film und seine Vorträge bestechen durch einen konstanten Wechsel zwischen sachlichen Informationen und emotionalen Stories. Die Auseinandersetzung mit dem Glück wird zum Wechselbad der Gefühle – wortreich und bildstark.
Und wer genauer hinsieht, dem fällt auf, dass selbst die rationalen Argumente als emotionale Trigger eingesetzt werden, denn Daten und Fakten werden nur geliefert, um das Publikum in Staunen zu versetzen. Ein Beispiel: In seinem Vortrag »7 Rules for making more happiness« lädt Sagmeister sein Publikum auf eine Zeitreise ein. Wäre er vor 100 Jahren geboren worden, hätte er den Beruf ergriffen, den bereits sein Vater gelernt hatte. Seine Mutter hätte das Mädchen ausgesucht, das er heiraten würde, und er wäre wahrscheinlich an dem gleichen Ort gestorben, an dem er geboren wurde. All das hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Heute können wir selbst entscheiden, wo wir leben – in Sagmeisters Fall in New York anstatt in Bregenz. Wir wählen uns selbst einen Beruf, Stefan Sagmeister wurde Graphiker und nicht Kaufmann wie sein Vater. Und wir bestimmen selbst – meistens jedenfalls –, in wen wir uns verlieben. Doch sind diese Entscheidungen tatsächlich so eigenständig und selbstbestimmt? Regiert nicht vielmehr unser Unterbewusstsein über die meisten Dinge in unserem Leben? Laut Sagmeister sprechen einige Statistiken dafür, dass wir unfreier sind, als wir denken. Warum zum Beispiel leben in Georgia mehr Männer mit dem Namen Georg als in jedem anderen Bundesland der USA? Warum steht bei amerikanischen Jungs, die Dennis heißen, der Berufswunsch Zahnarzt, Dentist, sehr viel weiter oben auf der Liste als bei Jungs mit anderem Namen? Warum heiraten Paulas überdurchschnittlich oft einen Paul? Sagmeister selbst hielt diese Statistiken für fragwürdig. Doch wird er von seiner eigenen Familie widerlegt: Sagmeisters Eltern heißen Karolina und Karl und seine Großeltern Josephine und Josef. Für die Antwort auf die Frage, ob wir selbst die Schmiede unseres Glücks oder nur Getriebene unseres Unterbewusstseins sind, wechselt Sagmeister hin und her zwischen Rationalität und Emotionalität, zwischen objektiven Statistiken und subjektiver Selbsterfahrung – ein Wechselspiel, das nicht nur für die Inhalte seines Vortrags gilt, sondern auch für die Form der Präsentation.
Emotionale Trigger in Wort und Bild
In seinen Geschichten setzt er kreativ und überraschend Bild und Wort im Wechsel geschickt ein, um das Publikum zum Hinhören und auch Hinschauen zu motivieren. Sagmeister bespielt dabei die ganze Klaviatur der Gefühle: Überraschung, Staunen, Freude, aber auch Trauer, Wut und Frust. Er selbst scheut nicht davor zurück, diese Gefühle auch auf der Bühne zu zeigen – mit dem Effekt, dass diese vom Publikum gespiegelt und empathisch aufgegriffen werden.
Am Ende ist sich Sagmeister auch nicht zu schade, im rosa Hasenkostüm durch New York zu hoppeln oder mit Hunderten von Luftballons in die Luft zu steigen. So jedenfalls die Idee. Im Film zwingt die harte Wahrheit den Glückssucher auf den Boden der Realität zurück. Anstatt die Leichtigkeit des Glücks zu spüren und durch die Luft zu schweben, muss sich Sagmeister auf einem schneebedeckten Acker vor den Toren New Yorks eingestehen, dass er auch für Hunderte von Luftballons schlichtweg zu schwer ist. So schleifen ihn die gelben Ballons eine kleine Weile am Boden entlang, aber so richtig abheben will er nicht. Ähnlich ist auch das Fazit seines Vortrags. Denn das Glück ist nicht so leicht zu fangen. Zurück lässt er ein begeistertes Publikum – mit gemischten Gefühlen, das sich vielleicht aber jetzt selbst auf die Suche nach dem Glück macht.
Sie suchen noch mehr Beispiele guter Vorträge, Präsentationen und Reden, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann – um sein Glück oder mehr zu finden? Dann lesen Sie weiter. In dem Buch, aus dem dieser Text stammt: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019.