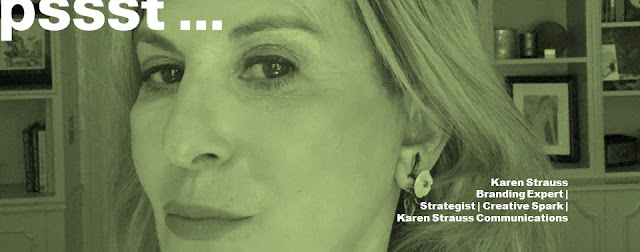Gefühlsduselei? – Warum Storytelling es immer noch so schwer hat

Henry Ford wusste ziemlich genau, wo die Schwierigkeiten liegen, wenn man mit Menschen arbeitet. In seiner Biografie »My Life and Work«, aus dem dieses Zitat stammt, macht er das deutlich. Zwischen den beiden Händen, die die Arbeit erledigen, liegen irgendwo auch ein Gehirn und ein Herz, und beide haben Bedürfnisse.»How come when I want a pair of hands I get a human being as well?« – Henry Ford
Heute wäre Ford erfreut darüber, dass große Teile der manuellen Arbeit, die er als Pionier der Massenproduktion standardisierte, von Maschinen erledigt werden können. Das Verhältnis Mensch zu Maschine, das uns heute im aufkommenden Zeitalter von Robotik und künstlicher Intelligenz so beschäftigt, war auch in der Gründerzeit das beherrschende Thema. Unternehmer wie Henry Ford befassten sich ihr ganzes Leben lang damit. Und auch für viele Künstler wurde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Abgrenzung des Menschen gegenüber der Maschine zum kreativen Treiber.
In der damals aufgeheizten Debatte um die Vorzüge von Technologie und Maschinenkult gab der Filmregisseur Fritz Lang 1927 eine bestechende Antwort. Sein epochaler und bis heute stilbildender Science- Fiction-Film »Metropolis« zeigt eine Zukunft, in der Menschen in einer von Maschinen abhängigen Welt leben. Und ganz gleich, ob sie in der Ober- oder der Unterwelt wohnen, ob sie zum privilegierten Bürgertum oder der armen Arbeiterschicht gehören, was alle Menschen eint und von Robotern unterscheidet, ist die Fähigkeit zu Mitgefühl und Empathie. So ist Langs Werk eine Hommage an die menschlichen Gefühle und eine Warnung vor der Diktatur und Tyrannei herzloser Maschinen.
Doch Langs Warnung wurde nicht gehört, der Film war an der Kinokasse ein Flop. Nach der Premiere am 10. Januar 1927 wurde er in nur einem einzigen Kino in Berlin gezeigt, wo in den folgenden vier Monaten nicht einmal 15.000 Besucher ein Ticket lösten. Dann zog die insolvente Ufa die Premierenfassung zurück. Erst Ende des 20. Jahrhunderts sollte es zur Wiederentdeckung des Films kommen.
Heute wird »Metropolis« als Klassiker expressionistischer Kunst hoch gelobt und als Vorreiter des Filmgenres Science-Fiction gefeiert. Unzählige Regisseure nahmen sich Fritz Lang zum Vorbild. Der für damalige Verhältnisse teuerste Film der Welt gilt heute als bedeutendstes Werk der Filmgeschichte und ist seit 2001 Weltdokumentenerbe der UNESCO. Den Kritikern damals war es einfach zu viel Technologiegläubigkeit, aber auch zu viel Gefühlsduselei. Selbst heute macht es der Film dem Zuschauer nicht leicht. Überzogen und übertrieben kommt uns die Mimik der Stummfilmschauspieler vor, pathetisch erscheinen Texte und Story. Doch nimmt man die historische Patina beiseite, tritt ein Thema hervor, das aktueller ist denn je.
Diskutieren wir nicht gerade heute darüber, was den Unterschied zwischen Mensch und Maschine ausmacht? Verteidigen wir nicht gerade heute Kreativität, Intuition und Inspiration als menschliche Vorzüge, die Maschinen niemals übernehmen können? Setzen wir nicht gerade heute auf Gefühlswelten, Emotionen und Empathie als Zeichen menschlicher Besonderheit – ganz besonders im Businessumfeld? Softskills werden als Managementqualitäten gepriesen. Teamgeist, Intuition, soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit erfahren ein Revival angesichts der Übermacht von Computerintelligenz und raffinierter Roboterfertigung.
Den Unterschied macht anscheinend das Herz. Und genau das sollte man in Ihrer nächsten Präsentation auch spüren. Denn nur Sie – als Mensch – sind fähig, auf die emotionalen Bedürfnisse Ihres Publikums einzugehen. Eine Maschine kann das nicht. Zumindest noch nicht.
»You’ll need to identify your audience’s emotional needs and meet them with integrity. It’s not enough to get the facts right – you’ve got to get the emotional arc right as well. Every storyteller is in the expectations- management business and must take responsibility for leading listeners effectively through the story experience, incorporating both surprise and fulfillment. At the end of the story, listeners should think, ›We never expected that – but somehow, it makes perfect sense.‹ Thus, a great story is never fully predictable through foresight – but it’s projectable through hindsight.«
Peter Gruber, Produzent von Filmen wie »Rain Man«, »Die Farbe Lila«, »Batman«, Flashdance« oder »The Kids Are All Right«, weiß um die Bedeutung emotionaler Bedürfnisse im Storytelling und sieht auch Redner in Vorträgen und Präsentationen in der Pflicht, die Gefühle des Publikums bewusst und aktiv anzusprechen.
Für die Kommunikationswissenschaftler Richard Maxwell und Robert Dickman sind Gefühle sogar ein wesentliches Element, um Geschichten zu definieren. Für sie ist eine Story
»a fact, wrapped in an emotion that compels us to take an action«.
Und Paul Smith, Autor von »Lead with a Story« verkürzt diese Definition sogar auf die Formel:
»Fact + Emotion + Action = Story«
So kurz, so einfach. Doch was sind eigentlich Emotionen, und mit welchen Mitteln wecken Geschichten große Gefühle?
Angstschweiß und Gänsehaut
Wer den Pixar-Animationsfilm »Alles steht Kopf« (Originaltitel: »Inside out«) aus dem Jahr 2015 kennt, der ist vertraut mit den fünf Hauptdarstellern des Films: Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Zentraler Schauplatz des Films ist der Kopf der kleinen Riley Andersen, und der Zuschauer erlebt das Heranwachsen des kleinen Mädchens aus der Perspektive ihrer fünf Hauptgefühle, die dank der Pixar Animateure alle in Form kleiner Zeichentrickfiguren auftreten.Wenn man den Anthropologen der University of California, Paul Ekman, fragt, würde er zu den fünf Helden der Pixar-Story noch zwei weitere hinzuaddieren, Überraschung und Verachtung. Denn laut Ekman sind Menschen sieben Basisemotionen eigen, egal in welchem Kulturkreis sie aufgewachsen sind. Je mehr Experten man befragt, umso mehr Gefühle kommen hinzu: Verlegenheit, Hass, Liebe, Staunen, Vertrauen. Die Liste unserer sogenannten Primäraffekte kann bis zu zwanzig Gefühle umfassen.
Jede dieser Emotionen ist ein psychophysiologisches Phänomen. Es wird ausgelöst durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation. Oft genügt aber auch schon ein einzelner Reiz, der uns an ein Ereignis erinnert, in dem wir eine Erfahrung gemacht haben, die zu einer Gefühlsregung geführt hat. Der Reiz allein kann diese Emotion wachrufen. Gefühle spiegeln somit gar nicht so sehr die äußeren Tatsachen wider, sondern reflektieren vielmehr unsere Beurteilung dessen, was wir wahrnehmen. Gefühle sind intuitive Reaktionen unseres Körpers.
Weite Teile des von Daniel Kahneman beschriebenen System 1, dem schnell reagierenden, intuitiven Denkzentrum, sind involviert, wenn es um Emotionen geht. Daher ist es auch gar nicht so leicht, diese zu beherrschen. Angstschweiß und Schrecksekunde, die Gänsehaut der Erregung und die Tränen der Rührung – sie alle sind kaum kontrollierbar. Gefühle können uns buchstäblich »übermannen« und nur mit großer Anstrengung »unterdrückt « werden.
In vielen Kulturen und über Jahrhunderte hinweg galt es als unschicklich, Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen – eben weil sie als Zeichen von psychischer Schwäche, Unkontrollierbarkeit und Unreife angesehen wurden. Auch heute noch empfindet man in vielen Bereichen »Emotionalität« als eher unangebracht. Der Theatermacher und Drehbuchautor Gregor Adamczyk sieht darin den Grund, warum Storytelling im Geschäftsalltag selten zum Einsatz kommt:
»Die meisten Menschen legen großen Wert darauf, im Beruf besonders professionell zu wirken. Leider verwechseln sie dabei nicht selten ihr Berufsleben mit einem Pokerspiel. Sie denken, sie würden nur dann kompetent erscheinen, wenn sie sich vollkommen im Griff haben. (...) Eine innere Einstellung jedoch, die uns einflüstert: ›Hinter jeder emotionalen Regung lauert die Gefahr des Gesichts- und Kompetenzverlusts‹, beraubt unsere Kommunikation ihrer wichtigsten Komponente: Emotionen.«
Mitdenken allein reicht aber nicht aus für einen guten Vortrag. Mitfühlen ist die Devise. Empathie garantiert höchste Aufmerksamkeit und Motivation sowie die Verankerung des Gesagten im Langzeitgedächtnis – auch wenn uns dieses im Business-Umfeld zunächst schwer fällt.
Sie brauchen noch mehr gute Gründe, um Storytelling in Rede, Vortrag und Präsentation einzubauen? Dann lesen Sie weiter. In dem Buch, aus dem dieser Text stammt: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019. Oder besuchen Sie einen meiner Vorträge oder Webinare. Alle Termine und Infos unter: www.petrasammer.com/about-petra-sammer/upcoming-events/