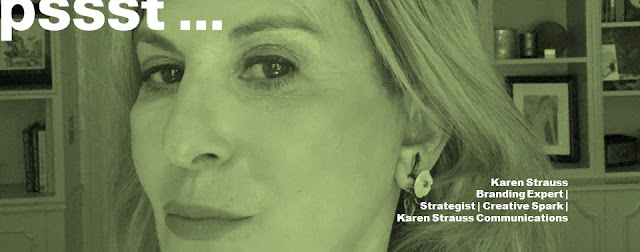Rauf auf die emotionale Achterbahn: Warum manche Reden Sie einfach mitnehmen
Chris Anderson, von dem dieser Tipp stammt, ist Kurator der TED-Konferenz, die seit 1984 Wissenschaftler, Innovatoren und außergewöhnliche Menschen auf die Bühne bittet. (…) Anderson hat zahlreiche TED-Sprecher auf ihren Auftritt vorbereitet. Oft wird er daher nach den entscheidenden Kriterien für eine gute Rede gefragt. Einer seiner wichtigsten Tipps ist, eine Präsentation als Geschichte zu verstehen und sich an narrativen Strukturen zu orientieren – Strukturen, die Sie sicher kennen:
Die Klassiker
Viele der klassischen Strukturmuster für Rede und Präsentation sind Ihnen vertraut, denn Sie haben sie in unzähligen Vorträgen gehört:Da ist der Report, der Faktum an Faktum systematisch reiht, um am Ende der Präsentation zu einer Zusammenfassung zu kommen, dem Publikum aber die Analyse des Gesagten zu überlassen.
Dann ist da die Erörterung, die ebenso Fakten aneinanderreiht, aber jede Information in eine Erkenntnis umwandelt. So ist der Schlusspunkt nicht nur eine Zusammenfassung, sondern auch eine Auswertung mit Mehrwert.
Interessant ist die Empfehlung, ein klassisches Verkaufsgespräch, in dem eine Lösung angepriesen wird. Mit der Empfehlung wird zunächst ein Bedürfnis thematisiert, das dann mithilfe eines Lösungsangebots überwunden werden kann.
Und auch das Drama dürfte ein Klassiker für Präsentationen sein. Hier wird das Publikum zu einem schwierigen Tiefpunkt geführt, um es am Schluss mit einer Lösung, einer Erlösung, aufzufangen.
Viele dieser Muster erscheinen logisch und basieren auf der Art und Weise, die uns wissenschaftliches Arbeiten lehrt: Information folgt auf Information, daraus erschließt sich die Conclusio. Doch funktionieren diese linearen Methoden heute noch? Funktionieren sie, in einer Zeit, in der wir laut Peter Bregman alle 18 Minuten eine konzentrierte Arbeit unterbrechen, um eine andere Arbeit einzuschieben oder um uns absichtlich abzulenken? In der wir alle 37 Minuten E-Mails checken und uns kontinulierlich von WhatsApps, Insta-Stories, Likes und Shares unterbrechen lassen und gar süchtig sind nach diesen kleinen Dopamin-Dosen aus dem Smartphone? (…)
Die Postmoderne
Wenn man ehrlich ist, hat das Strukturprinzip der Faktenauf- und erzählung auch schon vor den hektischen Zeiten des Internets nur unzureichend funktioniert. Dan Roam hat in seinem Buch »Blah Blah Blah: What To Do When Words Don’t Work« hierzu eine schöne Anekdote parat: Die Radio-Moderatorin Terry Gross trifft Jon Stewart zum Interview. Stewart ist Comedian, war lange Jahre Moderator der Nachrichtensatire »The Daily Show« und ist auch für seine Buchrezensionen bekannt. Während des Interviews fragt Gross den Buchrezensenten, ob er tatsächlich all die Bücher lesen würde, die er kommentiert. Stewart antwortet schlagfertig, dass er selbstverständlich beides lesen würde, den Klappentext auf der Vorderseite und auch den auf der Rückseite, um dann aber doch eine ernsthafte Antwort zu geben: »In manchen Wochen rezensieren wir bis zu vier Bücher, die auch ziemlich umfangreich sein können. Zum Beispiel historische Dokumentationen. Aber ich lese ziemlich schnell und versuche, so viel wie möglich aufzunehmen, und ich bin mittlerweile ganz gut darin, so viele Informationen wie möglich zu speichern ... für ungefähr vier bis sechs Stunden. Dann verschwindet das Wissen aus meinem Gehirn für den Rest meines Lebens (...).«Und weiter: »Ja, ich nehme die Fakten in einem Buch intensiv auf und bin plötzlich – sagen wir mal – Experte für die Konstruktion des Pentagon ... und dann, so gegen acht Uhr abends, denke ich mir: Wirklich? Ich weiß nicht mal mehr, dass es ein Gebäude mit fünf Seiten gibt.«
Geht es Ihnen auch manchmal so wie Jon Stewart? Dass Sie begeistert sind von einem Buch oder einer Rede – in dem Moment, in dem Sie lesen oder zuhören –, aber kurz danach ist alles komplett weg, ist so gut wie alles vergessen?
Wenn unserem Gehirn zu viele Fakten geboten werden ohne Hilfestellung, diese zu vertiefen oder zu verarbeiten, können wir vieles nicht verankern. Es kommt zwar zu einem kurzfristigen Wahrnehmungseffekt, nicht aber zu einem langfristigen Lerneffekt.
Lineare, sequenzielle Präsentationsstrukturen sind meist nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, einen langfristigen Eindruck zu hinterlassen. Hinzu kommt, dass wir mit dem klassischen Aufbau meist gegenläufig zur Aufmerksamkeitskurve des Publikums arbeiten: In der Regel ist ein Publikum besonders am Anfang einer Präsentation aufmerksam, weil es neugierig auf den Redner ist. Und dann kommt es wieder gegen Ende zu gesteigerter Aufmerksamkeit. Mittendrin kämpfen viele Zuhörer mit der Konzentration.
Komplett gegenläufig ist dagegen die Aufmerksamkeitskurve des Redners. Der ist oft am Anfang noch nervös und muss sich erst einmal warm sprechen, um dann langsam voll konzentriert zum Höhepunkt zu kommen. Hat ein Präsentator die Klimax seiner Rede erreicht, seine große Idee einmal ausgesprochen, sinkt meist sein Energielevel. Aus diesem Grund müssen Geschichten heute viel schneller zum Punkt, zum Höhepunkt, kommen. Es gilt, gegen die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Publikums zu arbeiten. Und gegen die Konkurrenz des Smartphones in Händen des Publikums. Gute Redner laden daher ihr Publikum auf eine emotionale Achterbahnfahrt ein.
Emotionale Achterbahnen
Als Steve Jobs das iPhone erstmals in der Öffentlichkeit präsentierte, war ihm seine Freude deutlich anzusehen. Die Apple-Fans, die 2007 zur McWorld gekommen waren, kannten bereits das Ritual, mit dem Steve Jobs am Ende seiner Rede stets eine Weltneuheit ankündigte, immer mit den Worten: »There is one more thing ...«An diesem Tag allerdings, am 9. Januar 2007, eröffnete Jobs seine Rede mit den Worten »This is a day ... I’ve been looking forward to for two and a half years ...« Und es war klar, dass er diesen Moment zelebrieren würde. Er tat es, indem er seinem Publikum zunächst sehr, sehr kleine Häppchen lieferte. Und jedes dieser Häppchen war in sich eine eigene Geschichte: Jobs informierte seine Fans zunächst, dass Apple den Musikplayer iPod komplett überarbeitet habe und neu auf den Markt bringen würde. Dass man gleichzeitig auch das Telefon revolutioniert habe. Und dass man letztendlich das Internet für die Hosentasche erfunden habe und auch dieses auf den Markt bringen würde. Lange spannt Jobs seine Zuhörer auf die Folter, wie diese Produkte wohl aussehen würden. Jedes einzelne Feature präsentiert er, als sei es das ultimative Highlight der Rede. So reihte er Höhepunkt an Höhepunkt, um schließlich doch noch zu offenbaren, dass er von einem einzigen Gerät spricht, das alle diese Dinge vereinigt, dem iPhone.
Nach dem 9. Januar 2007 sollte die Welt eine andere sein. Telefonhersteller verloren ihre Marktmacht und wurden fast komplett vom Markt gewischt. Die Art und Weise, wie man Computer und Bildschirme bediente und steuerte, änderte sich grundlegend, und Generationen veränderten komplett ihr Informations- und Kommunikationsverhalten. Und das alles auch dank einer Rede, die nicht dem klassischen Strukturmuster eines Businessvortrags folgte, sondern die das Publikum auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnahm.
Sparkline
Nancy Duarte gab der Struktur mit den kleinen Häppchen, wie sie Steve Jobs erzählte, einen Namen: Sparkline. Dafür hatte sie nicht nur Jobs Rede, sondern auch Reden von Martin Luther King, Leonard Bernstein, Richard Feynman und vielen anderen analysiert. Bei allen fiel ihr dieses ganz besondere Muster auf: ein Rhythmus, den sie mit einer auf- und einer absteigenden Linie visualisierte. Diese Linie beginnt zunächst auf niedrigem Niveau mit der Beschreibung eines Ist-Zustands (»was ist«), um sehr schnell nach Beginn der Rede auf ein höheres Niveau zu klettern, das den Wunschzustand markiert (»was sein könnte«). Gute Redner wechseln in ihrem Vortrag kontinuierlich zwischen diesen beiden Ebenen. Immer wieder führen sie neue Beweise und Thesen ein, die unterstreichen, wie wichtig es ist, vom Ist- zum Wunschzustand zu kommen. Redner, die ihr Publikum aufrufen wollen, diesen Wunschzustand herbeizuführen, motivieren mit kleinen Häppchen immer wieder neu. Redner, die die Lösung schon in der Tasche haben, lüften langsam ihr Geheimnis und präsentieren in kleinen Häppchen, warum ihre Lösung dem Wunschzustand entspricht.Duarte sieht in dem ständigen Wechsel zwischen »ist« und »soll« den Erfolg dieser Reden, die immer wieder kleine Spannungsbögen aufmachen, anstatt nur einen langen Bogen über die gesamte Rede hinweg aufzuziehen. Es ist also wohl wesentlich erfolgversprechender, einen Wechsel von These und Beleg zu präsentieren, anstatt einen langatmigen, detailverliebten Plan zu referieren.
Laden Sie also Ihr Publikum ein, auf eine Achterbahnfahrt und lesen Sie weiter … denn dieser Text stammt aus dem Buch: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019.Photo by Charlotte Coneybeer on Unsplash