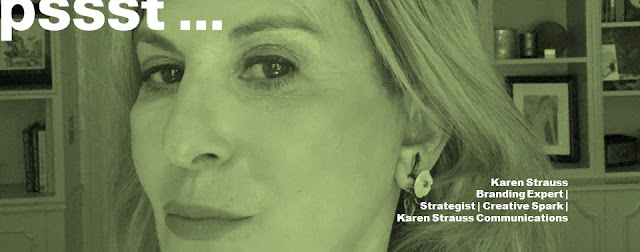5 Punkte, an denen jeder Storyteller arbeiten muss
Egal ob Präsentation, Vortrag, Rede, Anekdote, Parabel oder Metastory ... die Grundelemente einer guten Geschichte sind – ganz gleich ob klein oder groß – immer die gleichen. Es sind fünf neuralgische Punkte, an denen ein Storyteller arbeiten muss:
Abraham Maslow bietet ein hilfreiches Modell, um diese »Tiefe einer Story« anzulegen. In seiner Bedürfnis- Pyramide beschreibt der Psychologe die Grundbedürfnisse, die allen Menschen eigen sind. Die unterste Ebene der Pyramide bilden die essenziellen Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen und Trinken. Um sie geht es hier nicht. Konzentrieren wir uns auf die nächsthöheren Ebenen: Jeder von uns mag unterschiedliche Präferenzen und Schwerpunkte haben, aber wir alle sind angewiesen auf ein gewisses Maß an Sicherheit und Stabilität (1), wünschen uns die Zuneigung und Liebe anderer Menschen und wollen Teil einer Gemeinschaft sein (2). Der eine betont mehr als der andere seine Unabhängigkeit, braucht seine Freiheiten und will als einzigartiges Individuum anerkannt werden (3). Letztendlich wollen wir alle unsere Persönlichkeit entfalten und zum Ausdruck bringen (4).
Eine wirkungsvolle Rede bietet eine Geschichte, die genau auf diese Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte einzahlt. Den größten Effekt erzielen Sie, wenn Sie sich in Ihrer Kernstory auf eine der vier Ebenen konzentrieren. Prüfen Sie daher, ob sich eines der vier Bedürfnisse dafür eignet, mit Ihrem Thema verknüpft zu werden. Ist Ihre Rede zum Beispiel ein Versprechen für eine stärkere Gemeinschaft? Möchten Sie das „Wir-Gefühl“ dieser Gruppe festigen? Oder versprechen Sie Zuverlässigkeit und Stabilität für die Zukunft? Sprechen Sie über Veränderungsprozesse im Unternehmen oder Team und kündigen implizit Destabilität an? Dann fragen Sie sich, welches Grundbedürfnis durch die geplante Veränderung in Zukunft eher befriedigt werden wird und welches Angebot Sie im Sinne von Michael Maslow machen können. (…) Aber Vorsicht! Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, alle Grundbedürfnisse gleichzeitig ansprechen zu wollen. Denn dann wird Ihre Rede beliebig und diffus – die Sinnstiftung, die Storytelling in Ihrer Rede und Ihrer Präsentation leisten soll, wird dann leider misslingen.
In den meisten Fällen sind Reden im Geschäftsumfeld allgemein gehalten und unspezifisch. Es werden grundsätzliche Entwicklungen angesprochen, allgemeine Umstände und Zusammenhänge aufgezeigt, gängige Tendenzen oder Trends erläutert. Es geht um Gruppen, Märkte, Regionen. Selten wird es konkret. Selten geht es um einzelne Personen, besondere Situationen und spezielle Vorkommnisse. Genau dies ist aber die Arbeitsweise von Storytelling. Geschichten sind immer exemplarisches Erzählen. Stories stellen eine individuelle Person in den Mittelpunkt, die sich in einer ganz bestimmten Situation befindet. Diese Beschränkung und Zuspitzung auf nur ein Beispiel fällt vielen Führungskräften und Managern schwer. Doch sie lohnt sich.
Ein Team aus Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen von der Washington University und der Carnegie Mellon University konnte dies mit einem interessanten Experiment nachweisen. Die Wissenschaftler luden Testpersonen dazu ein, einen Fragebogen zu einigen technischen Geräten auszufüllen. Der Inhalt der Umfrage selbst war irrelevant. Viel wichtiger war, dass die Teilnehmer für das Beantworten des Fragebogens fünf Dollar als kleine Belohnung bekamen. Zusammen mit dem Geld wurde jedem Teilnehmer zum Abschluss ein Umschlag ausgehändigt, in dem sich ein Spendenbrief von »Save the Children« befand, einer Organisation, die sich um Kinder in Not kümmert. Die Briefe waren nicht gleich. Ein Teil der Gruppe bekam einen allgemein gehaltenen Brief, der sachlich darüber informierte, dass zum Beispiel in Malawi über drei Millionen Kinder an Hunger litten und dass die Maisernte in Sambia aufgrund heftiger Regenfälle um 42 Prozent eingebrochen war und in der Folge eine Hungersnot drei Millionen Menschen bedrohte. Vier Millionen Angolaner – ein Drittel der Bevölkerung – wäre aufgrund des Bürgerkriegs gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und auf der Flucht, während über elf Millionen Menschen in Äthiopien auf sofortige Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen wären.
Die andere Hälfte der Testpersonen erhielt einen ganz anderen Brief: »Das Geld, das Sie spenden, geht direkt an Rokia, ein sieben Jahre altes Mädchen in Mali, Afrika. Rokia ist sehr arm, hat kaum Zugang zu Lebensmitteln, und wir fürchten, dass sie sogar an Hunger sterben könnte. Ihr Leben wird sich durch Ihre Spende erheblich verbessern. Mit Ihrer Unterstützung und der vieler anderer hilfsbereiter Sponsoren arbeiten wir, Save the Children, daran, Rokia zusammen mit ihrer Familie und der Gemeinschaft, in der sie lebt, zu unterstützen, medizinisch zu versorgen und sie auch in lebenswichtigen Hygieneaspekten zu unterrichten.«
Jeder Testteilnehmer konnte selbstständig entscheiden, ob er überhaupt spenden wollte, und wenn ja, wie viel. Die Wissenschaftler ließen die Testpersonen allein und baten nur darum, das Geld, falls sie spenden wollten, in den Umschlag zu stecken und dann einfach zu gehen. Das Ergebnis war erstaunlich: Im Durchschnitt spendeten Teilnehmer aus der ersten Gruppe, die den allgemeinen, sachlichen Brief erhalten hatte, 1,14 Dollar. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe, die Rokia per Brief kennengelernt hatten, spendeten doppelt so viel: 2,38 Dollar. George Loewenstein, Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe in diesem Forschungsteam, erklärt das Phänomen damit, dass der sachliche Brief die Testpersonen eben auch sachlich und analytisch motiviert. Emotionalität wird durch den Text eher unterdrückt. Anstatt also Empathie und Mitgefühl auszulösen, bewirken die Statistiken und Daten über das Leid in diesen Ländern sogar das Gegenteil. Je mehr sich die Testpersonen aber in ein individuelles Schicksal hineinversetzen konnten (»Das ist ein Mensch wie ich.«), umso eher wurde erfolgreich an ihre Hilfsbereitschaft appelliert.
Robert McKee überträgt das Einmaleins guter Stories, das er Drehbuchschreibern seit Jahrzehnten beibringt, auf Storytelling im Businessumfeld. Ganz wichtig ist ihm dabei die Bedeutung von Konflikt und Transformation. Für Manager und Führungskräfte ist dies jedoch ein heikles Thema. Ungern thematisiert man Probleme und Schwierigkeiten. Viel lieber spricht man über Lösungen, verbreitet Zuversicht, versichert Stabilität und zeigt auf, wie großartig das eigene Unternehmen ist, wie erfolgreich das Team die hochgesteckten Ziele erreicht hat und welche Umsatzrekorde durch das neue Produkt gebrochen wurden.
Es gibt sicher Situationen, in denen diese Aussagen notwendig sind, Storytelling ist aber keine solche. Eine Geschichte, die präsentiert, wie wunderbar die Welt ist und wie alle Widrigkeiten problemlos gemeistert werden, ist nur eines: sie ist langweilig. Denn das Spannende an Geschichten ist nicht die heile Welt, sondern der Konflikt. Wenn Sie eine Geschichte erzählen wollen, die auffällt, die motiviert, die begeistert und von der man auch nach Ihrem Vortrag noch sprechen wird, sollten Sie die Schattenseiten zur Sprache bringen und über Ecken und Kanten sprechen, die das Leben bereithält. Und keine Sorge, Menschen lieben diese Geschichten:
»People love hearing the war stories about people making something – that makes you real and relatable and it’s human nature to respect someone who works hard.«
Jacqueline Lara gibt diesen Rat Kunststudenten und Künstlern, die auf der Suche nach Sponsoren, Mäzenen und Sammlern sind. Auch in der Kunstwelt gilt es, Herausforderungen, vor denen ein Bildhauer oder Maler steht, offen anzusprechen, anstatt Atelierbesuchern den kreativen Prozess nur in rosigen Farben auszumalen. Zeigen Sie also Mut zum Problem. Erzählen Sie eine Geschichte, die auch die dunklen Seiten zeigt, und schildern Sie plastisch den Veränderungsprozess, den der Konflikt in Gang setzt.
»Es sind die großen und kleinen Dramen, die tragisch beginnen und doch gut ausgehen. Es sind die Geschichten über Menschen, die sich verändert haben, die für ihre Träume und Ideale kämpfen, Menschen, die über sich hinausgewachsen sind und aus ihren Fehlern gelernt haben.« – Gregor Adamczyk
Wählen Sie für Ihre Geschichte einen Helden, mit dem man sich identifizieren kann, geben Sie der Geschichte eine spannende Wendung, wecken Sie die Neugierde Ihrer Zuhörer und lassen Sie sie mitfühlen. Als Storyteller sind Sie nicht nur Informant oder Kommunikator, Sie sind immer auch Entertainer – und Reisebegleiter.
Gute Geschichten geben dem Zuhörer die Gelegenheit, in eine andere Welt zu reisen und dort einzutauchen. Immersion nennt man diesen Effekt, und je tiefer ein Publikum in die Welt der Geschichte eintaucht und mit der Hauptfigur mitgeht, umso emotionaler bindet es sich an die Story und auch an deren Erzähler. Immersion bietet darüber hinaus noch einen weiteren wichtigen Effekt: Sie besänftigt Skeptiker. Je emotionaler ein Zuhörer von der Geschichte berührt wird, umso weniger distanziert er sich von dem Vortragenden und seinen Argumenten. Chip und Dan Heath gehen auf diesen Aspekt in ihrem Buch »Made to Stick – Why Some Ideas Survive and Others Die« ein:
»The problem is that when you hit listeners between the eyes they respond by fighting back. The way you deliver a message to them is a cue to how they should react. If you make an argument, your’re implicitly asking them to evaluate your argument – judge it, debate it, critize it – and then argue back, at least in their minds. But with a story, (...), you engage the audience – you are involving people with the idea, asking them to participate with you«
Doch Viralität ist keine Erfindung des Internets. Gute Geschichten wurden immer schon weiter- und weitererzählt – denken Sie an »Hänsel und Gretel« oder an Gute-Nacht-Geschichten. Aber auch gute Business-Stories werden weitererzählt, zum Beispiel die Entstehungsgeschichte der Post-its, jener kleinen Haftzettel, die das Unternehmen 3M erstmals auf den Markt brachte. Einer der Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung bei 3M, Arthur Fry, war ein begeisterter Kirchenchorsänger. Fry nahm eine Fehlentwicklung aus seiner Firma mit nach Hause, einige schlecht klebende Zettel, für die 3M keine Verwendung hatte. Die Zettel sollten eigentlich entsorgt werden, denn bei 3M war man enttäuscht über die schlechte Wirkung des verwendeten Klebstoffs. Fry benutze die kleine Zettelchen, um die Einsätze in seinem Notenheft zu markieren –, und er war sehr froh darüber, dass sich die Klebezettel problemlos wieder lösen ließen. Ein Glücksfall für 3M, wie wir heute wissen. Diese Story wird in Innovations-Workshops immer wieder erzählt – sie ist Teil des Gründungsmythos von 3M und dient oft als Beweis dafür, dass man aus Fehlern lernen kann. Eine perfekte Story für 3M mit
»We all carry around a lifetime’s worth of stories – both personal and professional – probably more than you’re even aware of (...). At its most basic level, a story is `something that happened to somebody´, so think about all those `somebodies’ you can tell stories about: yourself, your customers, your company, your product, your colleagues, or your competition.« Darren Menabney
Was auch immer Sie erzählen wollen, diese fünf Bausteine helfen Ihnen, Ihre Story attraktiv zu gestalten. Wenn Ihnen diese Tipps noch nicht reichen, dann lesen Sie doch einfach weiter, denn dieser Text stammt aus dem Buch: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019. Oder aber Sie kommen in einen meiner Workshops. Zum Beispiel in das Webinar „Storytelling in Rede und Präsentation“ – am 15. September online. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite der news aktuell Academy. Ich freue mich auf Sie.
1. Warum erzählen? Die sinnstiftende Idee
Jede gute Geschichte hat einen guten Grund, erzählt zu werden. Das klingt banal, ist es aber nicht. Bei vielen Unternehmens- und Marken- Stories bleibt im Dunkeln, was die Geschichte im Kern eigentlich vermitteln will. Stürzen Sie sich also nicht einfach ins Storytelling, sondern überlegen Sie sorgfältig, warum man Ihnen zuhören soll. Je tiefer Sie dafür schürfen, umso besser. Ihr Publikum ist gekommen, um Ihren Vortrag zu hören, Sie können also von Interesse und einer gewissen Neugierde ausgehen. Doch Sie können mehr, als nur das Bedürfnis nach Informationen befriedigen. Gehen Sie tiefer.Abraham Maslow bietet ein hilfreiches Modell, um diese »Tiefe einer Story« anzulegen. In seiner Bedürfnis- Pyramide beschreibt der Psychologe die Grundbedürfnisse, die allen Menschen eigen sind. Die unterste Ebene der Pyramide bilden die essenziellen Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen und Trinken. Um sie geht es hier nicht. Konzentrieren wir uns auf die nächsthöheren Ebenen: Jeder von uns mag unterschiedliche Präferenzen und Schwerpunkte haben, aber wir alle sind angewiesen auf ein gewisses Maß an Sicherheit und Stabilität (1), wünschen uns die Zuneigung und Liebe anderer Menschen und wollen Teil einer Gemeinschaft sein (2). Der eine betont mehr als der andere seine Unabhängigkeit, braucht seine Freiheiten und will als einzigartiges Individuum anerkannt werden (3). Letztendlich wollen wir alle unsere Persönlichkeit entfalten und zum Ausdruck bringen (4).
Eine wirkungsvolle Rede bietet eine Geschichte, die genau auf diese Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte einzahlt. Den größten Effekt erzielen Sie, wenn Sie sich in Ihrer Kernstory auf eine der vier Ebenen konzentrieren. Prüfen Sie daher, ob sich eines der vier Bedürfnisse dafür eignet, mit Ihrem Thema verknüpft zu werden. Ist Ihre Rede zum Beispiel ein Versprechen für eine stärkere Gemeinschaft? Möchten Sie das „Wir-Gefühl“ dieser Gruppe festigen? Oder versprechen Sie Zuverlässigkeit und Stabilität für die Zukunft? Sprechen Sie über Veränderungsprozesse im Unternehmen oder Team und kündigen implizit Destabilität an? Dann fragen Sie sich, welches Grundbedürfnis durch die geplante Veränderung in Zukunft eher befriedigt werden wird und welches Angebot Sie im Sinne von Michael Maslow machen können. (…) Aber Vorsicht! Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, alle Grundbedürfnisse gleichzeitig ansprechen zu wollen. Denn dann wird Ihre Rede beliebig und diffus – die Sinnstiftung, die Storytelling in Ihrer Rede und Ihrer Präsentation leisten soll, wird dann leider misslingen.
2. Braucht es Held? Nein, aber Protagonisten
»If I look at the mass, I will never act. If I look at one, I will.« – Mutter TeresaAuch der zweite Baustein guten Storytellings scheint offensichtlich: Jede Geschichte hat einen Helden. Doch so einfach ist es auch hier nicht. Mit »Held« ist nicht Superman oder Batman gemeint. Es geht nicht um übermächtige Protagonisten mit Superkräften. Das, was man allgemein als einen Helden bezeichnet, sollte besser „Hauptfigur“ oder „Protagonist“ heißen. Es handelt sich um eine zentrale Figur, die im Mittelpunkt der Geschichte steht, die klar identifizierbar ist und mit der sich der Zuhörer und die Zuhörerin identifizieren können. Denn genau diese Person macht den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Präsentation und Storytelling.
In den meisten Fällen sind Reden im Geschäftsumfeld allgemein gehalten und unspezifisch. Es werden grundsätzliche Entwicklungen angesprochen, allgemeine Umstände und Zusammenhänge aufgezeigt, gängige Tendenzen oder Trends erläutert. Es geht um Gruppen, Märkte, Regionen. Selten wird es konkret. Selten geht es um einzelne Personen, besondere Situationen und spezielle Vorkommnisse. Genau dies ist aber die Arbeitsweise von Storytelling. Geschichten sind immer exemplarisches Erzählen. Stories stellen eine individuelle Person in den Mittelpunkt, die sich in einer ganz bestimmten Situation befindet. Diese Beschränkung und Zuspitzung auf nur ein Beispiel fällt vielen Führungskräften und Managern schwer. Doch sie lohnt sich.
Ein Team aus Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen von der Washington University und der Carnegie Mellon University konnte dies mit einem interessanten Experiment nachweisen. Die Wissenschaftler luden Testpersonen dazu ein, einen Fragebogen zu einigen technischen Geräten auszufüllen. Der Inhalt der Umfrage selbst war irrelevant. Viel wichtiger war, dass die Teilnehmer für das Beantworten des Fragebogens fünf Dollar als kleine Belohnung bekamen. Zusammen mit dem Geld wurde jedem Teilnehmer zum Abschluss ein Umschlag ausgehändigt, in dem sich ein Spendenbrief von »Save the Children« befand, einer Organisation, die sich um Kinder in Not kümmert. Die Briefe waren nicht gleich. Ein Teil der Gruppe bekam einen allgemein gehaltenen Brief, der sachlich darüber informierte, dass zum Beispiel in Malawi über drei Millionen Kinder an Hunger litten und dass die Maisernte in Sambia aufgrund heftiger Regenfälle um 42 Prozent eingebrochen war und in der Folge eine Hungersnot drei Millionen Menschen bedrohte. Vier Millionen Angolaner – ein Drittel der Bevölkerung – wäre aufgrund des Bürgerkriegs gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und auf der Flucht, während über elf Millionen Menschen in Äthiopien auf sofortige Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen wären.
Die andere Hälfte der Testpersonen erhielt einen ganz anderen Brief: »Das Geld, das Sie spenden, geht direkt an Rokia, ein sieben Jahre altes Mädchen in Mali, Afrika. Rokia ist sehr arm, hat kaum Zugang zu Lebensmitteln, und wir fürchten, dass sie sogar an Hunger sterben könnte. Ihr Leben wird sich durch Ihre Spende erheblich verbessern. Mit Ihrer Unterstützung und der vieler anderer hilfsbereiter Sponsoren arbeiten wir, Save the Children, daran, Rokia zusammen mit ihrer Familie und der Gemeinschaft, in der sie lebt, zu unterstützen, medizinisch zu versorgen und sie auch in lebenswichtigen Hygieneaspekten zu unterrichten.«
Jeder Testteilnehmer konnte selbstständig entscheiden, ob er überhaupt spenden wollte, und wenn ja, wie viel. Die Wissenschaftler ließen die Testpersonen allein und baten nur darum, das Geld, falls sie spenden wollten, in den Umschlag zu stecken und dann einfach zu gehen. Das Ergebnis war erstaunlich: Im Durchschnitt spendeten Teilnehmer aus der ersten Gruppe, die den allgemeinen, sachlichen Brief erhalten hatte, 1,14 Dollar. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe, die Rokia per Brief kennengelernt hatten, spendeten doppelt so viel: 2,38 Dollar. George Loewenstein, Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe in diesem Forschungsteam, erklärt das Phänomen damit, dass der sachliche Brief die Testpersonen eben auch sachlich und analytisch motiviert. Emotionalität wird durch den Text eher unterdrückt. Anstatt also Empathie und Mitgefühl auszulösen, bewirken die Statistiken und Daten über das Leid in diesen Ländern sogar das Gegenteil. Je mehr sich die Testpersonen aber in ein individuelles Schicksal hineinversetzen konnten (»Das ist ein Mensch wie ich.«), umso eher wurde erfolgreich an ihre Hilfsbereitschaft appelliert.
»For people to take action, they have to care.« – Dan HeathVerlassen Sie sich in Ihrer Rede also nicht nur auf allgemeine Aussagen, Daten und Statistiken. Erzählen Sie ergänzend eine individuelle, exemplarische Geschichte – mit einer zentralen Hauptfigur. Es lohnt sich.
3. Konflikte? Ja, denn in Geschichten geht’s um Veränderung
»The way to persuade the buyer is to get their attention with a story, and that is very difficult in this day and age of distraction. Story is the most effective way to get attention because what attracts human attention is change. As long as things are moving on an even keel, you pay attention to whatever you’re doing. But if something around you changes (...) that gets your attention.«Robert McKee überträgt das Einmaleins guter Stories, das er Drehbuchschreibern seit Jahrzehnten beibringt, auf Storytelling im Businessumfeld. Ganz wichtig ist ihm dabei die Bedeutung von Konflikt und Transformation. Für Manager und Führungskräfte ist dies jedoch ein heikles Thema. Ungern thematisiert man Probleme und Schwierigkeiten. Viel lieber spricht man über Lösungen, verbreitet Zuversicht, versichert Stabilität und zeigt auf, wie großartig das eigene Unternehmen ist, wie erfolgreich das Team die hochgesteckten Ziele erreicht hat und welche Umsatzrekorde durch das neue Produkt gebrochen wurden.
Es gibt sicher Situationen, in denen diese Aussagen notwendig sind, Storytelling ist aber keine solche. Eine Geschichte, die präsentiert, wie wunderbar die Welt ist und wie alle Widrigkeiten problemlos gemeistert werden, ist nur eines: sie ist langweilig. Denn das Spannende an Geschichten ist nicht die heile Welt, sondern der Konflikt. Wenn Sie eine Geschichte erzählen wollen, die auffällt, die motiviert, die begeistert und von der man auch nach Ihrem Vortrag noch sprechen wird, sollten Sie die Schattenseiten zur Sprache bringen und über Ecken und Kanten sprechen, die das Leben bereithält. Und keine Sorge, Menschen lieben diese Geschichten:
»People love hearing the war stories about people making something – that makes you real and relatable and it’s human nature to respect someone who works hard.«
Jacqueline Lara gibt diesen Rat Kunststudenten und Künstlern, die auf der Suche nach Sponsoren, Mäzenen und Sammlern sind. Auch in der Kunstwelt gilt es, Herausforderungen, vor denen ein Bildhauer oder Maler steht, offen anzusprechen, anstatt Atelierbesuchern den kreativen Prozess nur in rosigen Farben auszumalen. Zeigen Sie also Mut zum Problem. Erzählen Sie eine Geschichte, die auch die dunklen Seiten zeigt, und schildern Sie plastisch den Veränderungsprozess, den der Konflikt in Gang setzt.
»Show a clear conflict. And demonstrate a clear change. Your audience wants to learn how the conflict is solved. Wants to see the facts and emotions.« – Garr Raynolds
4. Herz und Schmerz: Geschichten sind emotional
Der vierte Erfolgsbaustein einer guten Geschichte: Jede gute Geschichte geht ans Herz, weckt Emotionen und löst Empathie, Mitgefühl, aus.»Es sind die großen und kleinen Dramen, die tragisch beginnen und doch gut ausgehen. Es sind die Geschichten über Menschen, die sich verändert haben, die für ihre Träume und Ideale kämpfen, Menschen, die über sich hinausgewachsen sind und aus ihren Fehlern gelernt haben.« – Gregor Adamczyk
Wählen Sie für Ihre Geschichte einen Helden, mit dem man sich identifizieren kann, geben Sie der Geschichte eine spannende Wendung, wecken Sie die Neugierde Ihrer Zuhörer und lassen Sie sie mitfühlen. Als Storyteller sind Sie nicht nur Informant oder Kommunikator, Sie sind immer auch Entertainer – und Reisebegleiter.
Gute Geschichten geben dem Zuhörer die Gelegenheit, in eine andere Welt zu reisen und dort einzutauchen. Immersion nennt man diesen Effekt, und je tiefer ein Publikum in die Welt der Geschichte eintaucht und mit der Hauptfigur mitgeht, umso emotionaler bindet es sich an die Story und auch an deren Erzähler. Immersion bietet darüber hinaus noch einen weiteren wichtigen Effekt: Sie besänftigt Skeptiker. Je emotionaler ein Zuhörer von der Geschichte berührt wird, umso weniger distanziert er sich von dem Vortragenden und seinen Argumenten. Chip und Dan Heath gehen auf diesen Aspekt in ihrem Buch »Made to Stick – Why Some Ideas Survive and Others Die« ein:
»The problem is that when you hit listeners between the eyes they respond by fighting back. The way you deliver a message to them is a cue to how they should react. If you make an argument, your’re implicitly asking them to evaluate your argument – judge it, debate it, critize it – and then argue back, at least in their minds. But with a story, (...), you engage the audience – you are involving people with the idea, asking them to participate with you«
5. Viralität? Keine Erfindung des Internets. Gute Geschichten werden weiterzählt
»Stories are powerful memes.« – Jonah SachsKein Wunder, dass sich ein Social-Media-Experte wie Jonah Sachs bei dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins bedient, um die virale Kraft von Geschichten zu beschreiben. Dawkins hatte den Begriff »meme« schon 1976 in Anlehnung an das menschliche Genom (»Gene«) benutzt, um damit Ideen, Überzeugungen und Verhaltensmuster zu kennzeichnen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und ähnlich wie Gene evolutionstheoretisch zu beachten sind. Sachs erweitert Dawkins Begriff, denn auch Geschichten werden von Generation zu Generation oder innerhalb von definierten Gruppen und Communitys weitergegeben, und daher gewinnen »Stories« – besonders im Zeitalter von Social Media – stetig an Bedeutung.
Doch Viralität ist keine Erfindung des Internets. Gute Geschichten wurden immer schon weiter- und weitererzählt – denken Sie an »Hänsel und Gretel« oder an Gute-Nacht-Geschichten. Aber auch gute Business-Stories werden weitererzählt, zum Beispiel die Entstehungsgeschichte der Post-its, jener kleinen Haftzettel, die das Unternehmen 3M erstmals auf den Markt brachte. Einer der Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung bei 3M, Arthur Fry, war ein begeisterter Kirchenchorsänger. Fry nahm eine Fehlentwicklung aus seiner Firma mit nach Hause, einige schlecht klebende Zettel, für die 3M keine Verwendung hatte. Die Zettel sollten eigentlich entsorgt werden, denn bei 3M war man enttäuscht über die schlechte Wirkung des verwendeten Klebstoffs. Fry benutze die kleine Zettelchen, um die Einsätze in seinem Notenheft zu markieren –, und er war sehr froh darüber, dass sich die Klebezettel problemlos wieder lösen ließen. Ein Glücksfall für 3M, wie wir heute wissen. Diese Story wird in Innovations-Workshops immer wieder erzählt – sie ist Teil des Gründungsmythos von 3M und dient oft als Beweis dafür, dass man aus Fehlern lernen kann. Eine perfekte Story für 3M mit
- einem sinnstiftenden Thema (»Aus Fehlern kann man lernen«),
- einem Helden oder – besser – einer Hauptfigur (»Arthur Fry«),
- einem Konflikt (fehlende Markierung in Notenheften) und einer spannenden Wendung (Fehlproduktion erweist sich als Glückgriff),
- einer emotional ansprechenden Erzählweise (Kirchenchor sorgt für „Kino im Kopf“) und
- Viralkraft (immer wieder gern erzählt).
»We all carry around a lifetime’s worth of stories – both personal and professional – probably more than you’re even aware of (...). At its most basic level, a story is `something that happened to somebody´, so think about all those `somebodies’ you can tell stories about: yourself, your customers, your company, your product, your colleagues, or your competition.« Darren Menabney
Was auch immer Sie erzählen wollen, diese fünf Bausteine helfen Ihnen, Ihre Story attraktiv zu gestalten. Wenn Ihnen diese Tipps noch nicht reichen, dann lesen Sie doch einfach weiter, denn dieser Text stammt aus dem Buch: What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen, O´Reilly, 2019. Oder aber Sie kommen in einen meiner Workshops. Zum Beispiel in das Webinar „Storytelling in Rede und Präsentation“ – am 15. September online. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite der news aktuell Academy. Ich freue mich auf Sie.