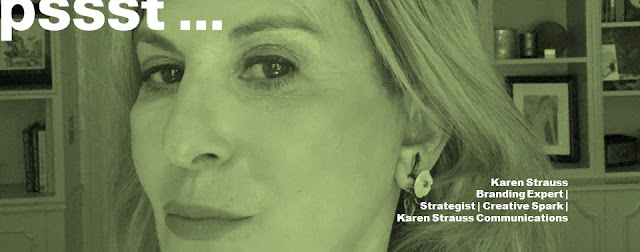Post-its für´s Gehirn

»Liebe gilt oft als eines der höchsten Gefühle, (die) man empfinden kann. Entsprechend tief kann man fallen. Denkt man so darüber nach, ist es fast absurd, wenn man sich an eine einzige Person bindet ..., sind da draußen doch noch so viele mehr (...) Aber wie entscheidet man sich (...) für die richtige Person? Es ist die Balance zwischen Geduld und Initiative ergreifen. Mathematiker haben eine interessante Strategie entwickelt, um genau das herauszufinden.Die Multimedia-Producerin Bettina Monn wollte (in ihrer Bachelorarbeit an der FH Graubünden) wissen, wie sich Menschen effizient ineinander verlieben – und wie sich Menschen am besten Fakten merken. Für ihre Arbeit erstellte Monn zwei Animationsfilme. Im ersten Film mit dem Titel »Liebe nach Plan« präsentiert sie die wichtigsten Fakten rund ums Verlieben als sachliches Erklärvideo. Im zweiten Film erzählt sie die gleichen Fakten verpackt in eine Geschichte, die mit den Worten beginnt »Meine erste große Liebe lernte ich mit 17 kennen. Für mich stand fest, dass wir füreinander geschaffen waren und uns nichts auf der Welt auseinanderbringen konnte. Doch dann wollte mein Partner plötzlich Neues ausprobieren – ohne mich. Mein Herz sprang in tausend Einzelteile ...«
Wenn man mit 16 Jahren die ersten Dating-Erfahrungen sammelt und spätestens mit 35 den Partner fürs Leben gefunden haben möchte, wird man in dieser Zeitspanne mal besser, mal schlechter geeignete Partner kennenlernen. Die Strategie besagt, dass man im ersten Drittel der Dating-Zeit alle potenziellen Kandidaten ablehnen soll, um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Danach soll man sich für die Person entscheiden, welche besser ist als alle vergangenen. Wenn man diese Strategie befolgt, liegt die Chance, den bestmöglichen Partner zu finden, immerhin bei 37 Prozent – bei einer x-beliebigen Wahl liegt die Chance bei gerade mal bei fünf Prozent.« – Bettina Monn
Beide Filme erklären, wie man den perfekten Partner unter 7,5 Milliarden Menschen weltweit findet. Und Monn will wissen, welche der beiden Filmversionen beim Publikum den besseren Lerneffekt erzielt.
Ihr Ergebnis ist nicht überraschend und doch erstaunlich: Storytelling hat einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg. Die Betrachter der Filmversion mit Story weisen einen um 15,6 Prozent höheren Lernerfolg auf und können sich Fakten aus dem Video wesentlich besser merken als die Vergleichsgruppe, die das sachliche Erklärvideo rezipiert. Auch wenn ihre Stichprobe klein ist, so kann diese Bachelorarbeit doch als aktueller Beleg für die Wirkung von Geschichten gewertet werden.
Tipp: Die beiden Filme – mit und ohne Storytelling – sowie eine filmische Zusammenfassung finden sich auf der Webseite von Bettina Monn unter dem Stichwort »Liebe nach Plan«.
Nicht nur links, sondern auch rechts aktiviert
Storytelling ist nachweislich aufmerksamkeitsstärker und merkfähiger als rationale Informationsvermittlung. Grund dafür ist die Art und Weise, wie unser Gehirn Geschichten verarbeitet. Neuroscans belegen, dass die Verarbeitung von rationalen Informationen in unserem Gehirn auf zwei Bereiche beschränkt ist: das Broca- Areal, den Bereich unseres Gehirns, der für die Sprachproduktion verantwortlich ist, und das Wernicke-Areal, den Bereich, der für das Sprachverständnis zuständig ist. Beide Areale sind im Scan auf der linken Seite des menschlichen Gehirns zu sehen.Eine gut erzählte Geschichte dagegen aktiviert nicht nur die linke Gehirnhälfte, sondern weit mehr Bereiche - wie etwa den Motorkortex, der komplexe Bewegungsabläufe steuert oder den somatosensorischen Kortex, der unterstützt, haptische Wahrnehmungen wie Regungen auf der Haut zu interpretieren und zu fühlen. Auch der präfrontale Kortex an der Stirnseite unseres Gehirns wird durch Stories aktiviert. Dieser Teil ist mit dem limbischen System verbunden, das unsere Emotionen steuert. In Geschichten fühlen wir also nicht nur das Gesagt, wir gleichen auch Gehörtes mit Erlebtem ab. Diesen Erfahrungsabgleich wies der spanische Neurowissenschaftler Julio Gonzalez sogar anhand einzelner Wörter nach.
Mithilfe einer MRT (Magnetresonanztomografie) beobachtete er das Gehirn von Patienten während der Informationsaufnahme und Verarbeitung bestimmter Wörter. Dabei war deutlich zu sehen, dass konkrete Begriffe wie »Kaffee« oder »Parfüm« eine Vielzahl von Gehirnarealen, zum Beispiel auch olfaktorische Sensorbereiche, aktivierten. Bei abstrakten oder neutralen Begriffen wie »Konzept« oder »Strategie« blieben die meisten dieser Areale jedoch dunkel.
Dies erklärt auch, warum es Zuhörern leichter fällt, einer Geschichte zuzuhören, genauso wie es auch Sprechern leichter fällt, eine Geschichte zu erzählen – als abstrakte Themen. Abstrakte Begriffe erfordern vom Redner mehr Fokus, Konzentration und Energie, denn nur das Broca-Wernicke-Areal kann für die Verarbeitung und Ausgabe dieser Begriffe herangezogen werden. Wer dagegen Geschichten erzählt, kann auf die Mithilfe vieler weiterer Gehirnregionen bauen.
Sprecher eines komplexen, abstrakten Texts müssen für ihren Vortrag daher meist auf ein Redemanuskript zurückgreifen. Eine Geschichte lässt sich dagegen viel einfacher frei rezitieren. Oft reichen nur wenige Stichworte als Gedankenstütze, und der Sprecher kann die Lücken zur ganzen Story ohne Manuskript füllen.
Kognitionspsychologen verweisen in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Methoden, wie Wissen im Gehirn abgespeichert wird: Wir memorieren Faktenwissen anders als episodisches Wissen und haben dementsprechend ein faktisches Gedächtnis und ein episodisches Gedächtnis.
Wissen unterschiedlich abgespeichert
Wissen, das wir aus Erinnerungen und Erfahrung schöpfen (episodisches Wissen), ist weit besser verankert und einfacher abrufbar als pures Faktenwissen: Wenn wir uns an die »Mona Lisa« erinnern, rufen wir ein Bild vor unser geistiges Auge. Zur Erinnerung an eine Liedzeile gehen wir im Geiste die Melodie passend zu dem Text durch, und bei der Frage nach unserem Elternhaus rufen wir eine ganze Vielzahl an Erinnerungen ab, die uns helfen, an den physischen Ort gedanklich zurückzukehren.Fachwissen, mit dem wir keine eigenen Erfahrungen verbinden (wie etwa die Frage nach der Hauptstadt eines Landes, es sei denn, Sie haben einen persönlichen Bezug zu dem Ort), oder abstraktes Wissen (wie zum Beispiel die Frage nach der Definition des Begriffs »Wahrheit «) erfordern eine ganz andere Anstrengung unseres Gehirns.
Kein Wunder also, dass es Zuhörern einer Präsentation schwerer fällt, abstraktes Fachwissen zu registrieren und zu memorieren. Ganz zu schweigen von den Rednern selbst. Ein einfaches Experiment der Marketingprofessorin Jennifer Aaker an der Stanford Graduate School of Business bestätigt dies.
Aaker bat ihre Studenten, eine einminütige Präsentation zu halten – einen »Pitch«, wie das Amerikaner nennen. Nur einer von zehn ihrer Studenten und Studentinnen setzte beim Pitch auf die Technik des Storytellings. Alle anderen präsentierten mit herkömmlichen Methoden, mit Fakten, Daten und Statistiken. Die Professorin bat anschließend alle aufzuschreiben, was sie sich aus den Pitches der Mitstudenten gemerkt hatten. Von den zahlreichen Statistiken konnten die Zuhörer nur fünf Prozent wiedergeben, während sich 63 Prozent an die Geschichten erinnerten.
Doch ist dieser Lerneffekt durch Stories auch von Dauer? Genau das wollten Neurowissenschaftler der Wirtschaftsfakultät an der Emory Universität Atlanta herausfinden:
»Most people can identify books that have made great impressions on them and, subjectively, changed the way they think. Some can even point to a book that has changed their life. Stephen King, for example, said that Lord of the Flies changed his life, ›because it is both a story with a message and because it is a great tale of adventure.‹ Joyce Carol Oates pointed to Alice in Wonderland as ›the book that most influenced her imaginative life.‹ It seems plausible that if something as simple as a book can leave the impression that one's life has been changed, then perhaps it is powerful enough to cause changes in brain function and structure.« – Gregory S. BernsGregory Berns und sein Team untersuchten den Einfluss, den Geschichten langfristig auf das Gehirn haben, indem sie ihre Studienteilnehmer baten, regelmäßig am Abend vor dem Einschlafen eine Geschichte zu lesen. Und in der Tat wurde ihre Annahme bestätigt. Mithilfe der MRT (Magnetresonanztomografie) waren tatsächlich Veränderungen in verschiedenen Gehirnregionen nachweisbar, die bei der nicht lesende Vergleichsgruppe nicht zu sehen waren. Dieser lang anhaltende Lerneffekt hängt aber auch damit zusammen, wie wir mit Informationen, die in Geschichten verpackt sind, umgehen. Denn Faktenwissen nehmen wir sehr oberflächlich war. Wir »registrieren « diese Informationen lediglich. Informationen, die in Stories vermittelt werden, erleben und erfahren wir. Wir tauchen in Geschichten ein, sind mittendrin und voll dabei.
Mit welchem Gehirnareal auch immer wir Geschichten auf- und wahrnehmen, Fakt ist, sie heften sich wie Post-its an unser Gedächtnis – und diesen Effekt will doch jeder als Redner: einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Brauchen Sie noch mehr Argumente, um zukünftig mehr auf Storytelling zu setzten? Dann lesen Sie doch weiter. In dem Buch, aus dem dieser Textauszug stammt: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal – ganz wie Sie wollen.