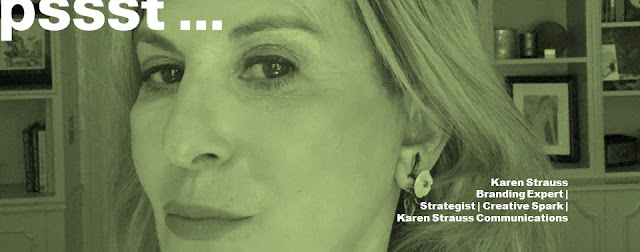Hören Sie auf zu trommeln. Erzählen Sie!
Geschichten wirken sinnstiftend. Ihnen gelingt etwas, das Psychologen »Kontextualisierung« nennen, denn sie verbinden Fakten durch einen roten Faden und weben aus einzelnen Informationsstücken einen sinnvollen Zusammenhang. Einem Puzzle gleich, setzen Geschichten Informationen, Fakten und Daten zu einem Gesamtbild zusammen. Sie machen es dem Zuhörer einfacher, Bruchstücke von Informationen zu erfassen, in einen Kontext zu setzen, zu verstehen und deren Gesamtbedeutung zu erkennen.
Als Vortragender sollte man immer im Auge behalten, dass Zuhörer nach Zusammenhängen suchen. Liefert ein Redner keinen roten Faden, irritiert das die Rezipienten. Als Ergebnis wenden sich Zuhörer ab, werden unkonzentriert, oder aber versuchen selbst, Zusammenhängen zu konstruieren.
Entscheidet sich der Zuhörer dazu, selbst eine sinnstiftende Verknüpfung herzustellen, verlieren Sie dessen Aufmerksamkeit: Sie »verlieren« Ihr Publikum.
Entscheidet das Publikum, dass es sich lohnt, weiter aufmerksam zuzuhören – weil Sie als Redner hohes Vertrauen genießen (Expertenstatus) oder einige Ihrer Informationen besonders reizvoll erscheinen (Anreizsystem) –, dann folgt das Publikum dem roten Faden, den Sie anbieten.
Machthungrige Dreiecke und eifersüchtige Kreise
Dass Menschen immer nach Zusammenhängen und Erklärungen suchen, haben die beiden Psychologen Fritz Heider und Marianne Simmel bereits 1944 mit einem kleinen Experiment nachweisen können. Ihre experimentelle Studie wurde in den vergangenen 70 Jahren oft wiederholt – immer mit dem gleichen erstaunlichen Ergebnis: Heider und Simmel zeigten ihren Studenten einen kurzen, animierten Film mit geometrischen Figuren. Die Psychologen baten ihre Testpersonen anschließend zu beschreiben, was im Film zu sehen sei.Überraschenderweise behaupteten über 70 Prozent der Zuschauer, sie hätten eine Geschichte gesehen. Sie berichteten von Liebesdramen und Eifersuchtsszenen, manche sahen einen Häuserkampf und Machtspiele, und wieder andere erzählten, es sei ein Geschwisterpaar wie Hänsel und Gretel zu sehen, das sich gegen eine böse Hexe verteidigen müsse. Nur eine Minderheit, knapp 30 Prozent der Zuschauer, berichtete, was tatsächlich zu sehen war: ein großes und ein kleines Dreieck sowie ein kleiner Kreis bewegen sich unrhythmisch um einige Striche herum.
Eigentlich habe ich schon jetzt schon viel zu viel verraten, denn sehen Sie sich den Film doch selbst an.
Das Heider-Simmel-Experiment markiert den Beginn der Attributionsforschung, mit der Psychologen erklären, wie Menschen einzelne Informationen nutzen, um daraus kausale Erklärungen abzuleiten. Vor allem gilt dies im Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir jemanden die Stirn runzeln sehen, suchen wir unwillkürlich nach einem Grund dafür – zum Beispiel Missbilligung oder Ablehnung. Dass ein Mensch die Stirn zufällig runzelt (was ja tatsächlich vorkommen kann), ziehen wir in der Regel nicht in Erwägung, da wir – so die Attributionsforschung – alle unsere Beobachtungen in einen sinnvollen Zusammenhang setzen und eine Erklärung für unsere Beobachtung suchen.
Vorsicht vor „Story Bias“!
Der Schweizer Schriftsteller und Unternehmer Rolf Dobelli, bekannt für sein Bekenntnis zur »Kunst des klaren Denkens«, macht darauf aufmerksam, dass wir selbst Zufälle der Geschichte in Erklärungen und »Geschichten« packen und dadurch oft falsche Schlüsse ziehen. Er nennt diesen Denkfehler »Story Bias«:»Das Leben ist ein Wirrwarr, schlimmer als ein Wollknäuel. (...) Dieses Chaos von Einzelheiten zwirnen wir zu einer Geschichte. Wir wollen, dass unser Leben einen Strang bildet, dem wir folgen können. Viele nennen diese Leitschnur ›Sinn‹. (...) Dasselbe stellen wir mit den Details der Weltgeschichte an. Wir zwängen sie in eine widerspruchslose Geschichte. Das Resultat? Plötzlich ›verstehen‹ wir zum Beispiel, warum der Versailler Vertrag zum Zweiten Weltkrieg wurde oder (...) warum der Eiserne Vorhang fallen musste oder Harry Potter zum Bestseller wurde. (...) Wir konstruieren den ›Sinn‹ nachträglich hinein. Geschichten sind also eine fragwürdige Sache – aber scheinbar können wir nicht ohne.«
Das ist doch logisch, oder?
Die Gefahr, unverstanden zu bleiben, wenn man pure Informationen – Fakten und Daten – ohne Kontext und ohne Geschichte liefert, ist selbstverständlich groß. Noch größer ist jedoch die Gefahr, wenn Redner glauben, eine schlüssige Geschichte zu vermitteln, während die Zuhörer tatsächlich nur unzusammenhängende Teilinformationen zu hören bekommen.Elizabeth Newton, Psychologin an der Standford University, hat dies in ihrer Dissertation 1990 mit einem ganz wunderbaren Test veranschaulicht: Newton teilte eine Testgruppe in Zweierteams auf: Ein Teilnehmer des Duos sollte Takt und Rhythmus eines Lieds trommeln, indem er auf die Tischplatte klopft. Der andere Teilnehmer sollte zuhören und versuchen, das Lied zu erkennen. Der Trommler hatte die Auswahl aus einer Reihe von Liedern, die jeder kennt, zum Beispiel »Happy Birthday«, ein bekanntes Kinderlied oder die Nationalhymne. Er wählte ein Lied aus, ohne es dem Zuhörer zu nennen. Dieser wiederum sollte das Lied ausschließlich anhand des rhythmischen Klopfens auf der Tischkannte erraten.
Bevor die Pärchen loslegten, fragte Elizabeth Newton die Trommler, zu wie viel Prozent sie glaubten, dass ihr jeweiliger Zuhörer das Lied erkennen würde. Im Durchschnitt gingen die Klopfer – Männer und Frauen – von einer 50-prozentigen Chance aus. Männer waren mit 57 Prozent sogar etwas optimistischer als Frauen (43 Prozent). Die Realität lieferte jedoch ein ganz anderes Ergebnis. Tatsächlich erwies es sich für die Zuhörer als äußerst schwierig, das Lied zu erkennen. Nur 3 von 120 Versuchen wurden erkannt. Das entspricht einer Quote von 2,5 Prozent. Während die Trommler von einer Chance im Verhältnis 1 zu 2 ausgingen, dass ihr Trommeln verstanden und erkannt werden würde, lag das reale Ergebnis bei 1 zu 40. Was ist der Grund für so ein massives Missverständnis?
»The tapper (...) subjects in this study were so embedded in their own imaginations – so caught up in the richness of the melodies they were ›hearing‹ – that they could not recognize how impoverished the same stimulus was from the perspective of the listener.«
Chip und Dan Heath, die mit ihrem Buch »Made to Stick« auf das Experiment von Elizabeth Newton aufmerksam machen, ziehen eine Parallele zu Präsentation und Rede. Sie ziehen die Parallele zu Geschäftsführern, die vor ihren Mitarbeitern präsentieren, zu Marketingleuten, die mit Kunden kommunizieren, zu Lehrern und Professoren, die vor Schülern und Lehrern referieren, zu Politikern, die mit Wählern sprechen. Denn sie alle trommeln.
Und sie trommeln mit einer Melodie im Kopf, die sie persönlich sehr gut kennen. Geschäftsführer kennen die Unternehmensstrategie, die sie über Monate hinweg entwickelt haben und die sie nun ihren Mitarbeitern präsentieren. Marketingleute kennen die Produkt- und Unternehmensmarke, für die sie arbeiten und die sie mit Kernbotschaften, Werbestrategien und -kampagnen dem Konsumenten näherbringen, in- und auswendig. Lehrer und Professoren zitieren in Unterricht und Vorlesung aus einem persönlichen Wissensschatz, den sie sich über Jahre hinweg angeeignet haben. Politiker greifen auf eine Fülle an komplexem Hintergrundwissen zurück und haben zahlreiche verschiedene Agenden im Kopf, die sie Wählern gegenüber vertreten.
Und was kommt beim Zuhörer an? Zusammenhangsloses Klopfen.
So sehr sich beide Seiten auch bemühen und anstrengen – der Trommler klopft noch nachdrücklicher und entschiedener, der Zuhörer hört noch angestrengter hin –, das Ergebnis bleibt immer das Gleiche: Unverständnis.
Was fehlt, ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die Einzelinformationen verbindet, die eine Logik in Daten und Fakten bringt und die diese in eine »verständliche Melodie« wandelt. Eine Geschichte, die Informationen einen Sinn gibt.
Also trommeln Sie nicht, sondern erzählen Sie. Sehen Sie sich das wunderbare Video von Jeff Walker an, in dem er dieses Phänomen, »The Curse of Knowledge« hervorragend erklärt und lesen Sie weiter. Denn dieser Text stammt aus dem Buch: „What´s your Story? Leadership Storytelling für Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die etwas bewegen wollen“ – ein Buch, das allen Mut macht, mehr zu erzählen anstatt nur zu präsentieren. Erschienen 2019 bei O´Reilly, erhältlich bei Ihrem lokalen Buchhändler, bei amazon, bei O´Reilly, Thalia oder GenialLokal
Photo by Mark Leishman on Unsplash