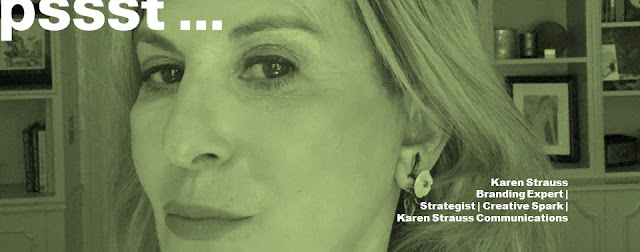Die Droge des Storytellings: Immersion
Denn erst das „Eintauchen“ in eine Erzählwelt, das Mitgehen mit der Hauptfigur in dessen Lebenswelt, das sich Verlieren in einer Umgebung, die uns vertraut und doch auch fremd sein kann, erst das alles macht das Geschichtenerzählen zum wahren Vergnügen. Es ist eine Erfahrung, die wir mit jeder neuen Geschichte, sehnsuchtsvoll erwarten und die uns auch maßlos enttäuscht, wenn sie sich nicht einstellt. Schlechte Geschichten sind wie kalter Entzug.
Einstiegsdroge: Märchen
Schon früh werden wir an diese Droge herangeführt: Gute-Nacht-Geschichten und Märchen legen im Kleinkindalter den Grundstein für eine lebenslange Sucht. Der Sucht nach Immersion.Das Wort leitet sich aus dem lateinischen „immersio“ ab, das „eintauchen“ und auch „untertauchen“ bedeutet. Ein wunderbarer semantischer Zufall, denn eine gute Geschichte – ob im Buch, im Kinofilm, in der Serie oder in einem Computerspiel - lässt uns gleichsam eintauchen, aber auch für Stunden ab- und untertauchen.
Schriftsteller, Drehbuchautoren und Gamedesigner arbeiten genau auf diesen Moment hin: das Publikum zu ködern, es in die Geschichte hineinzuziehen und dann dort möglichst lange zu fesseln.
Storyteller in Werbung und Unternehmenskommunikation wollen ebenso von dem Momentum der Immersion profitieren: sie wollen die Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken, sie in die Produkt- oder Unternehmensstory hineinziehen und den Kunden dann möglichst lange binden. Retention nennt man das im Marketingjargon. Eintauchen und Abtauchen ist also auch hier das Ideal.
Storyteller in Werbung und Unternehmenskommunikation wollen ebenso von dem Momentum der Immersion profitieren: sie wollen die Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken, sie in die Produkt- oder Unternehmensstory hineinziehen und den Kunden dann möglichst lange binden. Retention nennt man das im Marketingjargon. Eintauchen und Abtauchen ist also auch hier das Ideal.
Eine Fremdsprache lernen
Sprachwissenschaftler benutzen den Begriff der Immersion, um das Lernen einer Fremdsprache zu bezeichnen, in einer Umgebung in der ausschließlich die zu erlernende Sprache gesprochen wird. Der Lernende taucht also in die Welt der neuen Sprache ein, um sie besser zu verstehen.
Auch diese Definition lässt sich hervorragend auf die Wirkungsweise einer guten Story übertragen: denn in jeder Geschichte wird dem Publikum eine Welt präsentiert, in der bestimmte Regeln herrschen. Entweder findet eine Geschichte in der realen Welt statt, in der unsere Alltagsregeln herrschen – angefangen von Schwerkraft bis hin zu juristischen Gesetzen und christlichen Werte wie etwa „Du sollst nicht töten“. Die Geschichte kann aber auch in einer fiktiven Welt stattfinden wie etwa der Zauberwelt von Harry Potter: dort gelten sowohl die Regeln der Zauberei, als auch die Regeln der „normalen Welt“, denn Harry und seine Freunde wechseln zwischen beiden Welten hin und her. Oder aber man taucht ein in fantastische Welten, wie in „Game of Thrones“, wo Drachen existieren oder in „Zoomania“, dem Animationsfilm, wo Tiere Jobs haben wie Polizist oder Bürgermeister.
Auch diese Definition lässt sich hervorragend auf die Wirkungsweise einer guten Story übertragen: denn in jeder Geschichte wird dem Publikum eine Welt präsentiert, in der bestimmte Regeln herrschen. Entweder findet eine Geschichte in der realen Welt statt, in der unsere Alltagsregeln herrschen – angefangen von Schwerkraft bis hin zu juristischen Gesetzen und christlichen Werte wie etwa „Du sollst nicht töten“. Die Geschichte kann aber auch in einer fiktiven Welt stattfinden wie etwa der Zauberwelt von Harry Potter: dort gelten sowohl die Regeln der Zauberei, als auch die Regeln der „normalen Welt“, denn Harry und seine Freunde wechseln zwischen beiden Welten hin und her. Oder aber man taucht ein in fantastische Welten, wie in „Game of Thrones“, wo Drachen existieren oder in „Zoomania“, dem Animationsfilm, wo Tiere Jobs haben wie Polizist oder Bürgermeister.
Zu Beginn jeder Geschichte werden die Regeln der jeweiligen Welt erklärt. Immersion passiert nur dann – und das macht eine gute Geschichte aus - wenn die Regeln dieser Erzählwelt konstant eingehalten werden. Je komplexer und detailreicher diese Welt dargestellt wird, umso stärker ist der Immersionseffekt. Gamer wissen wohl am besten, von was hier die Rede ist.
Für kurze Formate wie Insta-Stories und Mini-Videos kann dies zum Problem werden. Denn die „Erzählwelt“ dieser sogenannten „Geschichten“ kann nur in winzigen Momenten am Anfang eingeführt werden und auch der Weg des „Eintauchens“ ist extrem verkürzt. Ganz im Gegenteil zu Streaming-Serien, die mehrere Episoden einer Staffel nutzen können, um unterschiedliche Protagonisten und deren Umfeld einzuführen.
Diese verkürzte Zeit ist mit ein Grund, warum der Immersionseffekt einzelner Insta-Stories weit geringer ist. Und warum viele Kurzformate daher gerne auf bestehende „Welten“ zurückgreifen. Es ist kein Zufall, dass die meisten Werbespots des Super Bowls 2020 auf bekannte, erfolgreiche Filme und Stories zurückverweisen und damit aus Erzählwelten zitieren, die dem Zuschauern bereits bekannt sind.
Pretty new: Immersives Storytelling
Doch auch wenn der Begriff der Immersion untrennbar mit der Kunst des Geschichtenerzählens verknüpft ist und jeder Storyteller seit Anbeginn der Menschheit, seit wir erzählen, bemüht ist, sein Publikum einzufangen und zu bannen – seit dem 18. Jahrhundert zum Beispiel wird das Licht im Theaterraum abgedunkelt, damit sich das Publikum besser konzentrieren und eintauchen kann – spricht man heute mehr und mehr von „immersivem Storytelling“ und meint damit eine ganz besondere Art des Erzählens. Eine neue Form des Geschichtenerzählens, die zwei Kriterien erfüllt:
Erstens: Das Publikum wird interaktiv in die Erzählung eingebunden. Der Autor behält vielleicht die Macht, die Erzählwelt zu gestalten, das Publikum wird aber aktiv am Plot beteiligt und bestimmt mit, was in dieser Welt passiert. Manche Computerspiele basieren sogar auf dem Prinzip, dass das Publikum die Welt selbst baut, wie etwa Minecraft oder Clash of Clans.
Zweitens: Die „vierte“ Wand fällt. Die Trennung zwischen Publikum und Bühne wird aufgehoben. Die „Entzauberung der Illusion des Theaters“ forderte bereits Berthold Brecht. Und das epische Theater, das er begründete hebt die Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne auf. Brecht hätte sich niemals erträumen lassen, dass eine Technologie wie „Virtual Reality“ seine Vision vom modernen Theater so konsequent umsetzen wird. Mit Hilfe einer VR-Brille steht der „Zuschauer“ heute mitten drin in der Erzählwelt und er ist – ganz wie es Brecht forderte – Rezipient und Akteur zugleich.
Doch auch ohne technologische Unterstützung wandelt sich das klassische Theater heute zum „immersive theatre“. Pionierarbeit leistet dabei Punchdrunk, die britische Performancegruppe, die in unglaublich aufwändigen Produktionen ganze Häuser, Fabriken, U-Bahn-Stationen umgestaltet, um Zuschauer mitten unter Schauspieler zu stecken und gemeinsam agieren zu lassen.
Secret Cinema sind die Wegbereiter der „immersive experience“ im Bereich Film. Hier werden ebenso Räume zum „Eintauchen“ gebaut – nicht als Theater- oder Filmkulisse - sondern als Erfahrungsraum. Es sind Rauminstallationen, die Gefühle und Erzählwelten wie „Blade Runner“ oder „Stranger Things“ nacherzählen und in denn der Besucher den Film nachempfinden kann. Es sind Erfahrungen, die gleichsam verzücken als auch verstören. Und: man muss dabei gewesen sein.
so beschreibt Thomas Oberender, der Leiter der Berliner Festspiele immersive Kunstwerke wie etwa die Installation „Nachlass – Pièces sans personnes“, die acht Zimmer zeigt, die für acht Menschen stehen, deren Leben zu Ende geht und die das repräsentieren, was nach dem Tod von diesen Menschen übrig bleibt. Man kann in diese Räume eintauchen, sie durchwandern und selbst die Geschichten recherchieren und erleben. Man ist Regisseur, Akteur und Publikum dieser Stories – alles in einem zugleich.
Immersive Storytelling ist somit auch, wenn Ikea eine zerbombte Wohnung aus Syrien in einem seiner Möbelmärkte nachbaut und die Kunden darin erspüren lässt, wie es sich anfühlt, mitten im Krieg zu wohnen. Oder wenn Edeka einen Supermarkt komplett leer räumt, um zu zeigen, wie fatal sich Diskriminierung und Nationalismus allein auf unser Lebensmittelangebot auswirken würde. Die Kunden erleben in Edeka#Vielfalt leere Regale, die erzählen, wie vielfältig unser Leben durch offene Grenzen und internationale Waren ist.
Und genau hier wird es von für Marketing und Unternehmenskommunikation ganz besonders interessant, denn Immersion ist eine Droge, von der wir einfach nicht genug bekommen können.
_______________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
Erstens: Das Publikum wird interaktiv in die Erzählung eingebunden. Der Autor behält vielleicht die Macht, die Erzählwelt zu gestalten, das Publikum wird aber aktiv am Plot beteiligt und bestimmt mit, was in dieser Welt passiert. Manche Computerspiele basieren sogar auf dem Prinzip, dass das Publikum die Welt selbst baut, wie etwa Minecraft oder Clash of Clans.
Zweitens: Die „vierte“ Wand fällt. Die Trennung zwischen Publikum und Bühne wird aufgehoben. Die „Entzauberung der Illusion des Theaters“ forderte bereits Berthold Brecht. Und das epische Theater, das er begründete hebt die Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne auf. Brecht hätte sich niemals erträumen lassen, dass eine Technologie wie „Virtual Reality“ seine Vision vom modernen Theater so konsequent umsetzen wird. Mit Hilfe einer VR-Brille steht der „Zuschauer“ heute mitten drin in der Erzählwelt und er ist – ganz wie es Brecht forderte – Rezipient und Akteur zugleich.
Doch auch ohne technologische Unterstützung wandelt sich das klassische Theater heute zum „immersive theatre“. Pionierarbeit leistet dabei Punchdrunk, die britische Performancegruppe, die in unglaublich aufwändigen Produktionen ganze Häuser, Fabriken, U-Bahn-Stationen umgestaltet, um Zuschauer mitten unter Schauspieler zu stecken und gemeinsam agieren zu lassen.
Secret Cinema sind die Wegbereiter der „immersive experience“ im Bereich Film. Hier werden ebenso Räume zum „Eintauchen“ gebaut – nicht als Theater- oder Filmkulisse - sondern als Erfahrungsraum. Es sind Rauminstallationen, die Gefühle und Erzählwelten wie „Blade Runner“ oder „Stranger Things“ nacherzählen und in denn der Besucher den Film nachempfinden kann. Es sind Erfahrungen, die gleichsam verzücken als auch verstören. Und: man muss dabei gewesen sein.
„Zu sehen sind oft andersartige Narrationen, die nicht mehr linear funktionieren,“
so beschreibt Thomas Oberender, der Leiter der Berliner Festspiele immersive Kunstwerke wie etwa die Installation „Nachlass – Pièces sans personnes“, die acht Zimmer zeigt, die für acht Menschen stehen, deren Leben zu Ende geht und die das repräsentieren, was nach dem Tod von diesen Menschen übrig bleibt. Man kann in diese Räume eintauchen, sie durchwandern und selbst die Geschichten recherchieren und erleben. Man ist Regisseur, Akteur und Publikum dieser Stories – alles in einem zugleich.
Immersive Storytelling ist somit auch, wenn Ikea eine zerbombte Wohnung aus Syrien in einem seiner Möbelmärkte nachbaut und die Kunden darin erspüren lässt, wie es sich anfühlt, mitten im Krieg zu wohnen. Oder wenn Edeka einen Supermarkt komplett leer räumt, um zu zeigen, wie fatal sich Diskriminierung und Nationalismus allein auf unser Lebensmittelangebot auswirken würde. Die Kunden erleben in Edeka#Vielfalt leere Regale, die erzählen, wie vielfältig unser Leben durch offene Grenzen und internationale Waren ist.
„Immersion kann ein intellektuell stimulierender Prozess sein; dennoch ist Immersion in den meisten Fällen, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart, geistig absorbierend und ein Prozess, eine Veränderung, ein Durchgang von einem Seelenzustand zum nächsten. Sie zeichnet sich durch schrumpfende kritische Distanz aus zu dem, was gezeigt wird und steigende emotionale Beteiligung an dem, was passiert“ sagt Medientheoretiker Oliver Grau in seinem Buch „Virtual Art. From Illusion to Immersion.“
Und genau hier wird es von für Marketing und Unternehmenskommunikation ganz besonders interessant, denn Immersion ist eine Droge, von der wir einfach nicht genug bekommen können.
_______________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
- Videotipp: Wunderbare Beispiele, was VR und AR heute schon ermöglichen, gibt es zu sehen in dem Video des Immersive Storytelling Symposium von „The New School“ mit dem Titel: „Exploration Narrative: Agency and VR experience“ – unbedingt ansehen.
- Buchtipp: Gute Geschichten ziehen uns in ihren Bann, bewegen uns und bleiben uns in Erinnerung. Wer etwas zu sagen hat, tut deshalb gut daran, Geschichten zu erzählen. Wie das geht – ganz besonders für Marketing und PR - das lernen Sie Schritt für Schritt in „Storytelling – Strategien und Best Practices für PR und Marketing“ von Petra Sammer, erschienen bei O´Reilly, 2. Auflage 2017
- Seminartipp: Storytelling erlernen – von den Basics bis zur Zukunft des Storytellings – hier sind einige Seminare für Sie zur Auswahl: https://www.petrasammer.com/storytelling/
Dieser Blogbeitrag ist inspiriert von Mounia Meiborgs Artikel „Eintauchen, bitte!“, Süddeutsche Zeitung, 26.7.2017
Photo by Julian Dufort on Unsplash
Photo by Julian Dufort on Unsplash