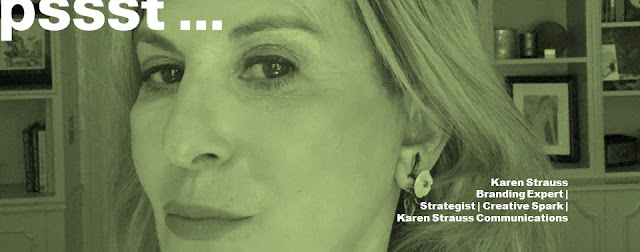Was lange währt, wird endlich ….Never-Ending-Story
Vor kurzem vertrat die Kulturwissenschaftlerin Dr. Nathalie Weidenfeld in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift „Der lange Abschied“ eine gewagt Thesen. Eigentlich zwei Thesen: die erste ist so erstaunlich wie die andere. Aber der Reihe nach.
Ihre Annahme ist, dass das ständige Betteln nach nicht-enden-wollenden Geschichten von Serien-Junkies – und das sind ja wohl die meisten von uns mittlerweile – genau das gleiche Verhalten sei, das Kinder abends im Bett bei der Gute-Nacht-Geschichte zeigen. Wir wollen immer, dass es weiter und weiter geht und dass die schöne, kuschelige, gemütliche Zeit des Geschichtenerzählens niemals ein Ende nimmt. Denn dann, wenn der Erzählstrom doch einen finalen Schlusspunkt gefunden hat, muss man Abschied nehmen von den geliebten Figuren und wird rausgestoßen aus der fantastischen Erzählwelt. Und dann muss man sich wieder dem langweiligen Alltag widmen, muss arbeiten gehen, muss sich um sein Leben kümmern, muss sich tatsächlichen Problemen widmen.
Ist da was dran? Nun, es klingt logisch, ist aber doch vielschichtiger als Weidenfeld es darstellt. Und soll in einem anderen Blogbeitrag mal Thema sein.
Zunächst fand ich auch diese These in Weidenfelds Artikel interessant, aber etwas weit hergeholt. Bis ich in meinen Schulaufgaben im Fach Deutsch blätterte.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum ich – im Alter von über 50 – immer noch die Schulaufgaben aus meiner Gymnasialzeit habe ... (Gott, das ist ja fast 40 Jahr her). Und warum ich weiß, wo in den Weiten meiner Regale, Ordner und Speicher diese zu finden sind … (Zugegeben, ich war in meiner Schulzeit ein Streber und räume auch heute noch immer gerne auf). Und natürlich die wichtigste Frage: warum ich da so „zufällig“ drin rumblättere... (Was soll man denn sonst machen, wenn man auf SocialMedia-Detox ist?).
Ich stöbere also in diesen Aufgabestellungen für Erörterungen, Aufsätze und Textanalysen, die mir meine wunderbaren Deutschlehrer*innen Anfang der 80er gaben und zitiere – mit Vergnügen und Entsetzen:
„Zeige anhand einer kleinen Wanderung in deinem Heimatort Schäden und Mängel in der Natur und erörtere, wie man diese verhindern könnte“ (Klasse 9c, Hausaufgabe vom 7. März 1983)
Oder:
„Die Ausstellung `Grün kaputt´ greift ein altes Thema – die Umweltzerstörung – unter verändertem Aspekt auf. Versuchen Sie diesen zu erkennen, zu (er)klären. – Setzen Sie sich kritisch mit einzelnen Themen auseinander!“ (Klasse 10d, 1. Schulaufgabe aus dem Deutschen vom 24. Oktober 1983)
Oder:
„`Unberührte Natur ist für mich ein Mysterium, eine unbegreifbare Erfahrung. Das Recht auf diese Erfahrung aber ist ein Grundrecht…´ (Ansel Adams, Photograf) - Erörtern Sie die Ursachen der Gefährdung der natürlichen Umwelt des Menschen und begründen Sie die Notwendigkeit ihrer Erhaltung.“ (Klasse 11c, 1. Schulaufgabe aus dem Deutschen am 5. November 1984).
Und gerne noch ein Beispiel:
„Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Belastung der Umwelt ist immer wieder die Forderung zu hören, die Menschen sollten anstatt ihrer Autos die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Nehmen Sie zu diesen Forderungen Stellung, indem Sie Vorteile und Nachteile des Individualverkehrs denen der öffentlichen Verkehrsmittel gegenüberstellen.“ (Klasse 11c, 4.Schulaufgabe aus dem Deutschen vom 20. Mai 1985).
Und vor allem unsere Lehrer. Und da ist noch mehr, was damals schon bekannt war. In der 11. Klasse bekamen wir sogar eine Themenauswahl. Wir durften uns die Aufgabe für die Prüfung aussuchen. Für alle, denen das Umweltthema zu langweilig war, gab es weitere aktuelle Themen - damals Anfang der 80er:
„Die Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland nimmt in jüngster Zeit immer mehr zu. Stellen Sie die Formen dar, in denen sie sich ausdrückt, und erörtern Sie geeignete Maßnahmen, um dieser Entwicklung gegenzusteuern.“
Es gab aber auch dieses Thema:
„Viele Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit mit Lesen und Fernsehen. Der Text nimmt Stellung zu der Frage, welche der beiden Beschäftigungen positiver zu bewerten ist. Erörtern Sie dieses Problem, indem Sie die Argumente des Textes einander gegenüberstellen und mit Hilfe Ihrer eigenen Erfahrung erläutern, und erweitern Sie die Liste der positiven bzw. negativen Argumente in bezug auf beide Medien durch eigene Gedanken.“
Hat Nathalia Weidenfeld also recht? Beschäftigen wir uns mit Themen wie Ökologie, Migration oder Medienkompetenz Jahr um Jahr wie ein Serien-Junkie - ohne Ende? Tauchen wir ein in die Erzählwelt der Argumente immer und immer wieder? Folgen wir längst bekannten Protagonisten und tauschen nur hin und wieder den einen oder andere Helden*in aus – also statt Petra Kelly heute eben Greta Thunberg?
Wer dieses Phänomen aus Storytelling-Perspektive betrachtet, der kann diesem Gedanken der seriellen Erzählung schon etwas abgewinnen. Und doch stört etwas.
Wir Menschen sehnen uns nach dem Ende, nach einem guten Abschluss, nach der Auflösung und Erlösung. Und dies sollte hoffentlich auch für die großen Metathemen der Menschheit gelten.
Diese Narrative mögen zwar immer wieder neu aufflammen und neu erzählt werden. Doch jede Generation führt das Thema zu seinem ganz eigenen Ende. FridaysforFuture arbeitet derzeit hart daran, das Umweltthema doch noch zu einem guten Ende zu bringen – ebenso wie viele Ingenieure, Biologen, Chemiker und Wissenschaftler dieser Generation.
Folgt man dem Modell von Gustav Frytag vom Fünfakter, dann haben wir Akt Nummer 3, die Klimax bzw. den Höhepunkt, schon überschritten und sind jetzt in Akt 4, der absteigenden Handlung. Wollen wir hoffen, das Akt 5, das Ende dann doch noch ein Happy End bringt.
Die Erklärung kommt nicht von mir, sondern von einer echten Wissenschaftlerin: von Dr. Annika Schach, Professorin für angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover. Sie zeigt in ihrem großartigen Buch „Storytelling und Narration“ sehr anschaulich, was den Unterschied ausmacht:
Wichtigstes Merkmal: Berichte sind ergebnisorientiert. Geschichten und Stories hingegen sind ereignisorientierte Texte. Geschichten in der Regel Auskunft über Ort und Zeitraum, in denen sie »spielen«, und sie führen eine Person ein, die etwas erlebt. Berichte funktionieren neutral und sind orts- und zeitunabhängig.
Berichte sind sachlich registrierende und neutrale Darstellungen. Geschichten sind subjektiv aus der Perspektive eines Erzählers erzählt. Berichte bemühen sich um eine objektive, möglichst nicht wertende Darstellung, Geschichten dagegen sind subjektiv-wertend und emotional in ihrer Darstellung.
Ganz entscheidend finde ich aber, dass für Annika Schach auch fest steht, dass man den Wahrheitsgehalt nicht an der Textgattung - ob Bericht oder Story - festmachen kann: beide können fiktiv oder eben Fake-News sein. Beide können wahr und real sein. Die Textgattung sagt nichts über den Wahrheitsgehalt aus, sondern nur draüber, aus welcher Perspektive ein Sachverhalt oder ein Vorgang erzählt wird. Eine Geschichte kann sehr wahr sein, wo ein gefälschter Report in die Irre führt und umgekehrt.
Von beiden aber kann man erwarten, dass sie zu einem – mehr oder weniger guten – Ende führen.
______________________________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
Und pssst… ein bisschen Umweltschutz mach ich jetzt auch. Für 2020 habe ich mir 12 TrashWalks vorgenommen. Was das ist, erfahren Sie hier.
Erstens behauptet Weidenfeld, dass Serien – und damit Streamingdienste, die vor allem auf Serien setzen – zur Infantilisierung der Gesellschaft beitragen.
Ihre Annahme ist, dass das ständige Betteln nach nicht-enden-wollenden Geschichten von Serien-Junkies – und das sind ja wohl die meisten von uns mittlerweile – genau das gleiche Verhalten sei, das Kinder abends im Bett bei der Gute-Nacht-Geschichte zeigen. Wir wollen immer, dass es weiter und weiter geht und dass die schöne, kuschelige, gemütliche Zeit des Geschichtenerzählens niemals ein Ende nimmt. Denn dann, wenn der Erzählstrom doch einen finalen Schlusspunkt gefunden hat, muss man Abschied nehmen von den geliebten Figuren und wird rausgestoßen aus der fantastischen Erzählwelt. Und dann muss man sich wieder dem langweiligen Alltag widmen, muss arbeiten gehen, muss sich um sein Leben kümmern, muss sich tatsächlichen Problemen widmen.
Ist da was dran? Nun, es klingt logisch, ist aber doch vielschichtiger als Weidenfeld es darstellt. Und soll in einem anderen Blogbeitrag mal Thema sein.
Die unendliche Geschichte
Hier möchte ich mich der zweiten steilen These von Nathalie Weidenfeld widmen: Laut ihrer Ansicht sind die „wichtigen Themen der Menschheit – wie Ökologie, Digitalisierung, Migration“ zu nie enden wollenden Serienthemen verkommen und die Treiber dieser Themen wie etwa Politik oder auch Technologie- und Internetfirmen bedienen sich ganz bewusst der Serienästhetik und Seriendramaturgie: ständig werden Dinge angekündigt, mit Cliffhangern versehen, um dann allerdings nicht bewältigt, sondern einfach nur weitererzählt zu werden.Zunächst fand ich auch diese These in Weidenfelds Artikel interessant, aber etwas weit hergeholt. Bis ich in meinen Schulaufgaben im Fach Deutsch blätterte.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum ich – im Alter von über 50 – immer noch die Schulaufgaben aus meiner Gymnasialzeit habe ... (Gott, das ist ja fast 40 Jahr her). Und warum ich weiß, wo in den Weiten meiner Regale, Ordner und Speicher diese zu finden sind … (Zugegeben, ich war in meiner Schulzeit ein Streber und räume auch heute noch immer gerne auf). Und natürlich die wichtigste Frage: warum ich da so „zufällig“ drin rumblättere... (Was soll man denn sonst machen, wenn man auf SocialMedia-Detox ist?).
Ich stöbere also in diesen Aufgabestellungen für Erörterungen, Aufsätze und Textanalysen, die mir meine wunderbaren Deutschlehrer*innen Anfang der 80er gaben und zitiere – mit Vergnügen und Entsetzen:
„Zeige anhand einer kleinen Wanderung in deinem Heimatort Schäden und Mängel in der Natur und erörtere, wie man diese verhindern könnte“ (Klasse 9c, Hausaufgabe vom 7. März 1983)
Oder:
„Die Ausstellung `Grün kaputt´ greift ein altes Thema – die Umweltzerstörung – unter verändertem Aspekt auf. Versuchen Sie diesen zu erkennen, zu (er)klären. – Setzen Sie sich kritisch mit einzelnen Themen auseinander!“ (Klasse 10d, 1. Schulaufgabe aus dem Deutschen vom 24. Oktober 1983)
Oder:
„`Unberührte Natur ist für mich ein Mysterium, eine unbegreifbare Erfahrung. Das Recht auf diese Erfahrung aber ist ein Grundrecht…´ (Ansel Adams, Photograf) - Erörtern Sie die Ursachen der Gefährdung der natürlichen Umwelt des Menschen und begründen Sie die Notwendigkeit ihrer Erhaltung.“ (Klasse 11c, 1. Schulaufgabe aus dem Deutschen am 5. November 1984).
Und gerne noch ein Beispiel:
„Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Belastung der Umwelt ist immer wieder die Forderung zu hören, die Menschen sollten anstatt ihrer Autos die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Nehmen Sie zu diesen Forderungen Stellung, indem Sie Vorteile und Nachteile des Individualverkehrs denen der öffentlichen Verkehrsmittel gegenüberstellen.“ (Klasse 11c, 4.Schulaufgabe aus dem Deutschen vom 20. Mai 1985).
Wir hatten es also damals schon gewusst, oder?
Und vor allem unsere Lehrer. Und da ist noch mehr, was damals schon bekannt war. In der 11. Klasse bekamen wir sogar eine Themenauswahl. Wir durften uns die Aufgabe für die Prüfung aussuchen. Für alle, denen das Umweltthema zu langweilig war, gab es weitere aktuelle Themen - damals Anfang der 80er:
„Die Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland nimmt in jüngster Zeit immer mehr zu. Stellen Sie die Formen dar, in denen sie sich ausdrückt, und erörtern Sie geeignete Maßnahmen, um dieser Entwicklung gegenzusteuern.“
Es gab aber auch dieses Thema:
„Viele Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit mit Lesen und Fernsehen. Der Text nimmt Stellung zu der Frage, welche der beiden Beschäftigungen positiver zu bewerten ist. Erörtern Sie dieses Problem, indem Sie die Argumente des Textes einander gegenüberstellen und mit Hilfe Ihrer eigenen Erfahrung erläutern, und erweitern Sie die Liste der positiven bzw. negativen Argumente in bezug auf beide Medien durch eigene Gedanken.“
Hat Nathalia Weidenfeld also recht? Beschäftigen wir uns mit Themen wie Ökologie, Migration oder Medienkompetenz Jahr um Jahr wie ein Serien-Junkie - ohne Ende? Tauchen wir ein in die Erzählwelt der Argumente immer und immer wieder? Folgen wir längst bekannten Protagonisten und tauschen nur hin und wieder den einen oder andere Helden*in aus – also statt Petra Kelly heute eben Greta Thunberg?
Wer dieses Phänomen aus Storytelling-Perspektive betrachtet, der kann diesem Gedanken der seriellen Erzählung schon etwas abgewinnen. Und doch stört etwas.
Die Sehnsucht nach dem Ende
Seit über 40.000 Jahren erzählt sich die Menschheit Geschichten. Die meisten davon folgen der Aristotelschen-Regel vom „Anfang, Mittelteil und Ende“. Und auch wenn das Format der Serie in den letzten Jahren populärer geworden ist und dank Netflix & Co. viel diskutiert wird, so ist es doch ersten nicht neu (Fortsetzungsromane gibt es seit dem 19. Jahrhundert und auch Märchen-Sammlungen wie „1000 und eine Nacht“ könnte man als Serienformat bezeichnen) und zweitens, arbeiten Serien sehr wohl mit dem „Ende“. In der am längsten erzählten Serie weltweit, den Simpsons, kommt jede Episode zu einem Ende. Jeder Erzählstrang wird irgendwann beendet und auch die ganze Serie wird eines Tages zu ende gehen (spätestens, wenn sie kein Geld mehr abwirft).Wir Menschen sehnen uns nach dem Ende, nach einem guten Abschluss, nach der Auflösung und Erlösung. Und dies sollte hoffentlich auch für die großen Metathemen der Menschheit gelten.
Diese Narrative mögen zwar immer wieder neu aufflammen und neu erzählt werden. Doch jede Generation führt das Thema zu seinem ganz eigenen Ende. FridaysforFuture arbeitet derzeit hart daran, das Umweltthema doch noch zu einem guten Ende zu bringen – ebenso wie viele Ingenieure, Biologen, Chemiker und Wissenschaftler dieser Generation.
Folgt man dem Modell von Gustav Frytag vom Fünfakter, dann haben wir Akt Nummer 3, die Klimax bzw. den Höhepunkt, schon überschritten und sind jetzt in Akt 4, der absteigenden Handlung. Wollen wir hoffen, das Akt 5, das Ende dann doch noch ein Happy End bringt.
Story versus Bericht: Was ist der Unterschied?
Der Vergleich der Diskussion von Metathemen mit Storytelling gibt mir zum Schluss aber noch die Möglichkeit, auf den Unterschied zwischen zwei Textgattungen aufmerksam zu machen. Ein Unterschied, der all denjenigen hilft, die sich mit der Definition von „Storytelling“ schwertun. Was ist der Unterschied zwischen „Bericht“ und „Story“?Die Erklärung kommt nicht von mir, sondern von einer echten Wissenschaftlerin: von Dr. Annika Schach, Professorin für angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover. Sie zeigt in ihrem großartigen Buch „Storytelling und Narration“ sehr anschaulich, was den Unterschied ausmacht:
Wichtigstes Merkmal: Berichte sind ergebnisorientiert. Geschichten und Stories hingegen sind ereignisorientierte Texte. Geschichten in der Regel Auskunft über Ort und Zeitraum, in denen sie »spielen«, und sie führen eine Person ein, die etwas erlebt. Berichte funktionieren neutral und sind orts- und zeitunabhängig.
Berichte sind sachlich registrierende und neutrale Darstellungen. Geschichten sind subjektiv aus der Perspektive eines Erzählers erzählt. Berichte bemühen sich um eine objektive, möglichst nicht wertende Darstellung, Geschichten dagegen sind subjektiv-wertend und emotional in ihrer Darstellung.
Ganz entscheidend finde ich aber, dass für Annika Schach auch fest steht, dass man den Wahrheitsgehalt nicht an der Textgattung - ob Bericht oder Story - festmachen kann: beide können fiktiv oder eben Fake-News sein. Beide können wahr und real sein. Die Textgattung sagt nichts über den Wahrheitsgehalt aus, sondern nur draüber, aus welcher Perspektive ein Sachverhalt oder ein Vorgang erzählt wird. Eine Geschichte kann sehr wahr sein, wo ein gefälschter Report in die Irre führt und umgekehrt.
Von beiden aber kann man erwarten, dass sie zu einem – mehr oder weniger guten – Ende führen.
______________________________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
- Sie wollen erzählen und erklären – am liebsten mit Video und Film? Dann ist der Filmworkshop „Frau Maier – wir brauchen Bewegtbild“ interessant für Sie. Ein Basiskurs für alle, die Filme machen wollen – egal ob für Unternehmen, Marke oder Produkt. Nächster Termin für geballte 5-Stunden Expertenwissen von Filmemacher Philipp Lenner und mir ist am 10. März in Stuttgart. Alle Infos hier.
- Sie haben etwas zu erzählen, wissen aber nicht wie? Dafür habe ich einen Buchtipp: "What´s your Story? Leadership-Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" - Holen Sie sich die wichtigsten Tipps und Tricks rund um Storytelling in Rede und Präsentation - Viel Spaß beim Lesen
- Noch mehr Storytelling, Textkompetenz und Online-Marketingkompetenz gibt es auf der Online Marketing Konferenz 2020 vom RheinwerkVerlag am 7./8.Mai in Köln, auf dem ich einen Vortrag und einen Workshop halte. Mehr Infos. Hier.
Und pssst… ein bisschen Umweltschutz mach ich jetzt auch. Für 2020 habe ich mir 12 TrashWalks vorgenommen. Was das ist, erfahren Sie hier.