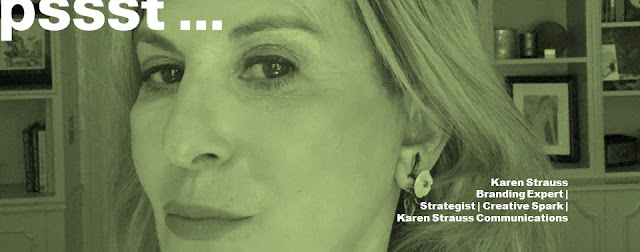Vom Ende her denken: Über das wichtigste Momentum einer Story
Die meisten von uns wissen aber auch schon am Anfang, wie diese Vorsätze enden werden: nach nur wenigen Tagen lässt die Disziplin nach. Die guten Vorsätze verschwinden auf Nimmerwiedersehen und tauchen erst am 31. Dezember des nächsten Jahres wieder auf. Und das Spiel geht von vorne los. (Übrigens, wer von Anfang an seine Vorsätze zu einem guten Ende führen will, der muss mindestens 66 Tage durchhalten – behautet jedenfalls die Psychologin Phillippa Lally in ihrer Studie.)
Das Ende ist von unendlicher Wichtigkeit. Wichtiger oft als der Anfang. Das Jahr 2020 mag schleppend oder gar krisenhaft anfangen. Entscheidend wird sein, wie es endet. Und bei der bedeutsamen Jahreszahl, wollen wir sogar wissen, wie das ganze Jahrzehnt endet. Zukunftsforscher und Trendscouts bemühen sich, um Prognosen, aber es bleibt ein wager Blick in die Kristallkugel. Noch nie erschien uns die Zukunft so schwer vorhersehbar wie heute.
Ganz anders ist das bei Geschichten. Diese werden nicht vom Schicksal und der Verkettung unglücklicher oder glücklicher Zufälle geschrieben. Das Publikum mag im Dunklen tappen, aber mindestens einer oder eine weiß genau, wie es ausgeht: der oder die Autor*in. Möchte man meinen.
Wie aufhören?
„Wie aufhören? Die Frage ist auch für Filmemacher oft schwer zu beantworten“, so stand es vor kurzem in einem wunderbaren Artikel im Zeit Magazin, über die Kunst, das richtige Ende zu finden. Denn es ist die Unwissenheit um das Ende, die eine Geschichten so spannend macht – und die extrem knifflig ist für Storyteller.
Eine wirklich gute Geschichte wird vom Ende her gedacht. Niemand hat das besser ausgedrückt, als Andrew Stanton, Regisseur bei Pixar, und verantwortlich für Filme wie ToyStory oder WallE:
„Storytelling is joke telling. It's knowing your punchline, your ending, knowing that everything you're saying, from the first sentence to the last, is leading to a singular goal, and ideally confirming some truth that deepens our understandings of who we are as human beings.”
Am Ende offenbart eine Geschichte ihren ganzen Sinn und Zweck. Je mehr Zusammenhänge, Handlungsstränge, Ereignisse und Erkenntnisse einer Story sich am Ende zu einem einzigen Ziel vereinen, umso eindrucksvoller wirkt die Geschichte auf ihr Publikum. Daher ist es so wichtig, am Anfang genau zu wissen, auf was alles am Ende hinauslaufen wird.
Am Ende geht es doch nur um Verkaufe, oder?
Die Bedeutung eines sinnstiftenden Endes gilt nicht nur für narrative Kunst wie Literatur, Film oder Theater. Sie gilt auch für Corporate- und Markenstories.
Storytelling in Marketing und PR muss auch und ganz besonders mehr leisten, als nur Profit oder Umsatz zu generieren. Wer dies nach Simon Sineks „Start with Why“ immer noch nicht verstanden hat, der sollte besser auf diese Kommunikationstechnik verzichten und stattdessen auf klassische Produktkommunikation setzen.
Corporate-Storyteller kennen den diffizilen Balanceakt, das Jonglieren zwischen Storyline, Plot und Markennennung. Wir alle kennen die Enttäuschung, wenn eine gute Story durch die ungeschickte Einblendung eines Markennamens oder die penetrante Produktpräsentation am Ende zerstört wird.
Besonders das Ende eines Image- oder Markefilms zeigt schonungslos, wie überzeugend die Handlung (Plot), wie relevant die Sinnstiftung (Storyline) und vor allem wie glaubwürdig die Marke wahrgenommen wird, die hinter einer Story steht.
Die Psychologie des Endes
Kein Wunder also, dass sich Storytelling-Berater damit auseinandersetzen, wie man eine Corporatestory zu einem guten Ende führt. Storytelling-Coach Donald Miller zum Beispiel, bekannt für seine Methodik „StoryBrand“, gibt drei Möglichkeiten für das richtige Ende:
- Der Held*in der Geschichte findet am Ende eine neue Kraft oder Position (und das Unternehmen oder Produkt hilft dabei),
- Der Held*in findet am Ende mit jemanden oder etwas wieder zusammen, und „komplettiert“ sich damit (und die Marke oder das Produkt ist wesentlich an der Wiedervereinigung beteilig), oder
- Der Held*in erfährt durch die Geschichte eine Art Selbstreflexion und wird damit zu einem besseren Menschen (und auch hier ist das Unternehmen oder die Marke, die die Geschichte erzählen, wesentlicher Bestandteil der Erkenntnis).
Drei unterschiedliche Endpunkte, drei gleiche Prinzipien: der oder die Held*in wird durch die Story transformiert und verändert – dank der Hilfe von Unternehmen, Marke oder Produkt. (Übrigens ist diese Veränderung des Helden ein ganz wesentliches Merkmal der Heldenreise von Joseph Campbell, dem Urmythos aller Geschichten, die eben auch für Corporatestories gilt).
Am Ende einer Story steht also, laut Donald Miller, nicht der plumpe Aufruf, etwas zu kaufen, sondern der Verweis, auf dominante, psychologische Grundbedürfnisse und deren emotionaler Relevanz für uns Menschen. Am Ende steht also so etwas wie „Sinnstiftung“, Simon Sineks „Reason Why“ oder eben „Purpose“.
Ende gut, alles gut
Wie wichtig dieses sinnstiftende Ende für uns als Publikum ist, drückte der Roman- und Sachbuchautor Matt Haig vor kurzem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus. Haig ist seit Jahrzehnten geplagt von schweren Depressionen und in vielen seiner Bücher wie „Ich und die Menschen“ reflektiert er diese Krankheit. Über Geschichten sagt er, dass sie für ihn wie Antidepressiva wirken, denn sie folgen einer klaren Dramaturgie:
„Depressionen haben keine Handlung, keinen erkennbaren Plot. Ich habe Literatur studiert und dabei gelernt, Geschichten, die einem erkennbaren Plot folgen, die Anfang, Mittelteil und Ende haben, zu misstrauen. Ich war ein ziemlich prätentiöser Literaturstudent, Happy End war sowieso das Letzte, aber auch sonst sollte es möglichst kryptisch sein. Aber als ich dann krank war, habe ich mich nach richtigen Geschichten gesehnt. Mit Handlung. Und damit eine Handlung eine Handlung ist, muss sich darin etwas verändern. Es gibt keine Handlung ohne Veränderung. Als es mir schlecht ging, war es etwas, woran ich glauben wollte, glauben musste: dass es Veränderung gibt.“
Psychologen nennen diesen Effekt „Kontextualisierung“. Sinnstiftung durch Geschichten, denn sie verknüpfen Geschehnisse und Ereignissen miteinander und machen so die Welt für uns besser erklärbar und verständlich. Einer der gewichtigsten Gründe, warum wir Happy Ends so lieben.
Unendliche Geschichten
Doch im 21.Jahrhundert ist nichts mehr einfach. Und so ist auch auf das Happy End immer weniger Verlass. Netflix-Fans wissend das, endet doch jede Staffel in der Regel nicht mit einer sinnstiftenden Auflösung, sondern mit einer noch größeren, irritierenden Katastrophe.
Joseph Campbells Heldenreise, in der der Held nach seinen Abenteuern verlässlich nach Hause zurückkehrt und sich alles zum Guten wendet, funktioniert nicht mehr. Und Aristoteles Grundregel, dass alles einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat, löst sich auf.
Die Simpsons, die erfolgreichste Serie der Welt, läuft ohne Ende seit 1989 in der 31. Staffel weiter und weiter. Die derzeit meistgesehene Serie, Big Bang Theory, ging nach 279 Episoden zwar kürzlich zu Ende, hätte aber noch ewig weiterlaufen können.
Autoren wie Richard Kropf, Bob Konrad und Hanno Hackforth, die Drehbücher für „Anna und die Liebe“ oder „4Blocks“ schrieben, wissen über die Qual der „Never-Ending-Story“, die Serien erfordern. So kommentieren sie ihre Arbeit im Zeit Magazin:
„Weil es eine Serie ist, ist das Ende kein Ende. Jetzt muss ein Anfang folgen. (…) Eine Situation, die abgeschlossen schien, bricht komplett auf, es gibt ein neues Spannungsfeld, eine Konstellation, die den Grund legt für die nächste Folge oder in diesem Fall die nächste Staffel.(…) In anderen Worten: Ein gutes Ende kann zugleich ein verdammt guter Neuanfang sein.“
Jedes Ende ein neuer Anfang
Weiter, immer weiter. Oliver Kahns Spruch gilt für Serien, aber gilt das auch für Unternehmenskommunikation und das Marketing? Müssen wir dort nicht doch mal einen Schlusspunkt setzen und tatsächlich über den Kauf sprechen?
Selbstverständlich macht es Sinn, eine Corporate-Story zum Beispiel die Geschichte eines Kunden, ein Fallbeispiel, positiv enden zu lassen. Schließlich wollten Sie ja erzählen, wie Sie einem Kunden helfen konnten.
Aber warum nicht auch mal einen Cliffhanger in der Unternehmenskommunikation probieren? Das Wort „Cliffhanger“ stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „Klippenhänger“. Der erste, der so bezeichnet wurde, hing tatsächlich an einer Klippe: 1873 wurde der Begriff erstmals in dem Roman „A Pair of Blue Eyes“ von Thomas Hardy verwendet. Das Buch wurde in einer Zeitschrift wöchentlich und kapitelweise publiziert. Eine Episode endete damit, dass der Protagonist, Henry Knight, am Steilhang des Bristol Kanals hängen blieb. Er hielt sich nur noch an einem Büschel Gras fest, um nicht in den Tod zu stürzen.
Die Leser waren fasziniert von dieser Szene und gleichzeitig geschockt, denn sie mussten nun eine Woche warten, um in der nächsten Ausgabe zu erfahren, ob Henry Knight es geschafft hat, zu überleben. Damit war der Fortsetzungsroman geboren. Und eine Methode der Kundenbindung, die bis heute von unzähligen Autoren, Filmemachern und auch Gamedesignern weiterverwendet wird.
Der Gestaltpsychologe Kurt Lewin und seine Mitarbeiterin Bluma Zeigarnik untersuchten in den 1920 das Phänomen des Cliffhangers psychologisch. Sie konnten nachweisen, dass sich Rezipienten an unterbrochene Handlungen besser erinnern als an vollendete. Dieser Umstand wurde nach Bluma Zeigarnik benannt: der „Zeigarnik-Effekt“.
Bevor Sie also Ihrem Kunden eine Geschichte lang und breit zu Ende erzählen, bauen Sie stattdessen doch mal einen Cliffhanger ein. Das heißt Sie stoppen Ihre Erzählung am spannendsten Teil. Und erzählen dann eben nächste Woche weiter.
Corporate- oder Markenstories sind nicht einfach nur kleine Geschichtchen. Es sind strategische Kommunikationskonzepte und Gesprächsangebot. Sie bringen sich mit Ihrem Kunden und Ihrer Zielgruppe ins Gespräch – weit über Ihr eigentliches Produktangebot hinaus.
Daher lohnt es sich durchaus, wie jeder gute Storyteller, immer vom Ende her zu denken.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 2020.
____________________________________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
- Wenn Sie den Vorsatz haben, 2020 mehr zu erzählen und weniger zu präsentieren, dann kommen Sie doch zu unserem Tagestraining "Storytelling". Zusammen mit dem Journalisten und Rhetorikprofi Georg von Stein optimieren wir Ihre Fähigkeiten rund um Storytelling und Präsentation. Termin ist der 17. März in München. Infos und Anmeldung einfach hier.
- Sie wollen es einfach und ganz nebenbei Ihre Storytelling-Techniken verbessern? Dann ist das Online-Training auf LinkedIn für Sie passend: "Storytelling für Führungskräfte" - über 15.000 Teilnehmer haben sich diesen Kurs bereits angesehen und Ihre Präsentations-Skills dadurch verbessert. Infos und Anmeldung hier.
- Ach Sie wollen erstmal nur was lesen zum Thema? Dann kommt hier ein Buchtipp: "What´s your Story? Leadership-Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" - damit holen Sie sich die wichtigsten Tipps und Tricks rund um Storytelling in Rede und Präsentation - Viel Spaß beim Lesen