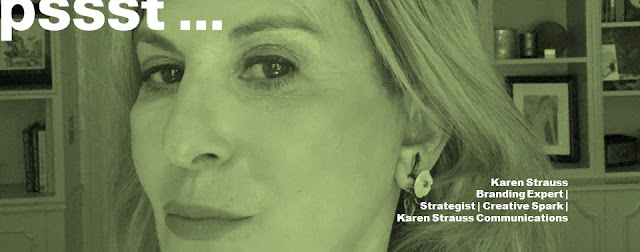Das glaubt doch kein Schwein, oder? Die Glaubwürdigkeit von Geschichten
Der Psychologe Steven Frenda veröffentlichte 2012 im Journal of Experimental Social Psychology eine beunruhigende Studie. Frenda und sein Team konnten anhand eines Experiments mit über 5.000 Teilnehmern belegen, dass Menschen offensichtlich falsche Nachrichten wesentlich leichter glauben und besser merken, wenn diese ihren eigenen Vorstellungen und vorgefassten Meinungen entsprechen. Steven zeigt den Probanden eine Reihe von Stories, einige wahre und einige, die ganz klar erfunden waren. Zum Beispiel, dass Barack Obama dem iranischen Präsidenten die Hand schüttelt oder Georg W. Bush während des Hurrikans Katrina mit einem prominenten Baseball-Profi gemütlich Urlaub mache. Konservative glaubten die Obama-Story eher, Demokraten erinnerten sich leichter an die Bush-Story. Teilnehmer aus beiden Lagern behaupteten sogar, dass sie die erfundenen Stories in offiziellen Nachrichten gesehen hätten. Am wirkungsvollsten waren vor allem Geschichten, die mit Bildern unterlegt waren.
Wir sind so leichtgläubig
Unter diesem Aspekt sei ein kritischer Blick auf ein Filmgenre erlaubt, dass in den letzten Jahren kreativen Aufwind bekommen hat – nämlich Semidocumentaries und sogenannte Biopics.Susan Vahabzadeh macht auf die Gefährlichkeit dieser Art des Erzählens in ihrer Filmkritik zu „Vice – der zweite Mann“ (2018), eine Filmbiographie von Regisseur und Drehbuchautor Adam McKay über den amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney aufmerksam. Ihr Artikel trägt den treffenden Titel „Riskanter Handel mit gefühlten Wahrheiten“, denn all zu leicht lassen wir uns von dieser Art Geschichten in unserer Meinung über Menschen beeinflussen. Filmbiographien folgen in der Regel dem historischen Verlauf der Geschichte und bilden in Teilen die Realität ab. Doch um die Story schlüssig zu machen, werden fiktiv Lücken geschlossen, die nicht dokumentiert sind. Und genau hier beginnt das Problem: das Publikum kann nicht unterscheiden, wo Wahrheit aufhört und Fiktion anfängt.
Und so urteilen wir als Zuschauer oft über eine Figur – und reale Person – anhand einer Mischung aus Realität und Fiktionalität, die sich zu einer undurchschaubaren, gefühlten Wahrheit zusammenbackt, die wir nicht mehr aus unserem Kopf verbannen können.
Was wissen wir schon über Mata Hari?
Susan Vahabzadeh ist ziemlich gnädig mit dem Kino, wenn es um die Verantwortung in dieser Frage geht: „Wann immer sich das Kino die Wirklichkeit zum Vorbild nimmt, und das tut es wahrlich oft, wird irgendjemand darauf hinweisen, dass die Abbildung nicht akkurat ist. (…) Sich fehlende Teile für ein Portrait auszumalen, ist vollkommen normal – jeder Spielfilm nach wahren Begebenheiten muss das tun, weil nie jede Sekunde eines Lebens eindeutig belegbar ist. (…) Wer sich Greta Garbo in „Mata Hari“ aus dem Jahr 1931 ansieht und dann glaubt, er wisse jetzt alles über die Spionin deren Leben diese Geschichte so ungefähr erzählt, ist selbst schuld. `Vice´ ist kein Dokumentarfilm,“ so Vahabzadeh.Doch bleibt ein fader Beigeschmack. Und der hat etwas mit den Zeiten zu tun, in denen wir jetzt leben. Vahabzadeh weiter: „Und doch fühlen sich Kinoliebhaber mit ungenauen Darstellungen nicht mehr so wohl wie früher. (…) Es hat früher andere Debatten übers Kino gegeben, über die Auswirkungen der Geschichten auf Menschen. Besonders heftig entbrannten sie um die Jahrtausendwende, als eine Reihe von Morden geschahen, die von Filmen inspiriert zu sein schienen, oder wo die Täter einen Film als Vorbild nannten. Es gab ein „Natural Born Killers“ Pärchen, einen „Scream“-Nachahmer, einen, der jemanden erstach und es auf „American Psycho“ schob, als wäre die Kunst für sein Handeln verantwortlich.“
Heute aber geht es gar nicht mehr um diese großen Taten. Es geht um viel kleinere Ungenauigkeiten, die uns nervös machen.
Viele kleine Lügen
Die Debatten um Fake News und Deep Fake sind am Kino und jedem Storyteller – egal ob im Entertainmentbereich, Journalismus, im Marketing oder in der Unternehmenskommunikation – nicht spurlos vorübergegangen. Denn Fake News wirken auf eine ganz spezielle Weise. Auf perfide Art.Laut Katarina Bader, Professorin für Online-Journalismus an der Hochschule der Medien in Stuttgart schenken wir dem Falschen zu viel Aufmerksamkeit. Im Kampf gegen Fake News geht es gar nicht um die offensichtlichen Lügen und Irrationalitäten. Fake News wirken nicht einzeln, sondern sie entfalten ihre fatale Kraft durch viele kleine Lügen, die eine Erzählung zementieren.
Um zu verstehen, wieso krasse Falschmeldungen die öffentliche Meinung so sehr beeinflussen können, genügt es nicht diese offensichtlichen Lügen zu analysieren und mit Fact-Checks zu widerlegen. Die Annahme, dass ein argloser Bürger auf Facebook eine erfundene Meldung sieht, diese fälschlicherweise glaubt, arglos weiterteilt und dass sich dadurch das öffentliche Meinungsbild verändert, ist schlichtweg falsch. Dieses Szenario geht an der Realität vorbei.
Das Problem sind gar nicht so sehr die großen Lügen. Sondern es sind die „vielen kleinen Lügen, die die Realitätswahrnehmung langsam verschieben. (…) Durch viele kleine Lügen wird ein Narrativ etabliert, das sofort aktivierbar ist (…), wenn etwas passiert, dass dieses Narrativ bestätigt“, so Bader.
Aktuell hat die Medienwissenschaftlerin drei Narrative ermittelt, die durch das Zusammenwirken dieser vielen kleinen Lügen derzeit prominent sind: Erstens, das Bedrohungsnarrativ, das suggeriert, dass deutsche Bürger von kriminellen Ausländern in ihrem alltäglichen Leben bedroht seien. Zweitens, das Vertuschungsnarrativ, wonach die politische Elite Deutschlands das eigene Land kriminellen Migranten ausliefere und dieses mit Hilfe von sog. Mainstream-Medien zu verstuschen versucht und drittens, das Diskriminierungsnarrative, in dem „normale Menschen“ und Menschen mit rechter Gesinnung nicht gehört und diskriminiert werden.
Gegennarrativ – dringend gesucht
Alle drei Narrative sind laut Bader gesamtdeutsche Erzählungen, die überall in Deutschland verbreitet sind und geglaubt werden. Als Aufgabe der Wissenschaft sieht sie, diese Narrative einzuordnen und besser zu verstehen. Aufgabe für alle Deutschen sieht sie es, diese Narrative zu entkräften. Allerdings genüge es nicht, diesem allein mit Zahlen und Fakten zu begegnen. Bauer sieht dies nicht als zielführend. Stattdessen gilt es – so die Medienwissenschaftlerin - ein glaubwürdiges und wirkungsmächtiges Gegennarrativ zu etabliert.Wie das geht, dafür nennt Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen ein Beispiel und Vorbild: Ursula von der Leyen. Ja, richtig gehört. Denn #Flinten-Uschi und #Zensursula hat es mit großartigem Storytelling geschafft, ein Gegennarrativ zu dem sexistische Minenfeld zu schaffen, aus dem diese Hashtags entstammen und darüber hinaus das EU-Parlament für sich zu gewinnen.
In ihrer Bewerbungsrede zur EU-Kommissionpräsidentschaft gelang es von der Leyen – in drei Sprachen – ihr eigenes Leben als vollkommen logische Hinführung genau zu diesem Amt zu erzählen: Die Liebe zu Europa habe sie von ihrem Vater, Ministerpräsident von Niedersachsen, übernommen, der zeit seines Lebens die Vision Europas befürwortete. Als Mutter von sieben Kindern liegt ihr die Zukunft Europas besonders am Herzen und es ist wohl Vorhersehung, dass Ursula von der Leyen in Brüssel geboren wurde.
Die richtige Story – und die Wahl des richtigen Narrativs macht den Unterschied, denn, so Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, „(Geschichten) sind Mythen des Alltags, Medium unserer geistigen Existenz, Ordnungsformen der Wirklichkeit. Sie stiften Sinn, verwandeln die Fragmente eines Lebens in schlüssige kausal verknüpfte Ereignisfolgen, die man sich immer wieder erzählt und irgendwann mit unbedingter Gewissheit glaubt. Auf einmal ist alles klar (…).“
Die Stunde der Erzähler
Doch laut Pörksen, steckt in der Kraft des Narrativs auch eine Gefahr und da reichen sich der Medienwissenschaftler und die Filmkritikerin Susanne Vahabzadeh die Hand: „Es ist in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung und der hektischen Sinnsuche im Informationsgestöber der Gegenwart die große Stunde der instrumentellen Erzähler, denen die Welt als Wille und Vorstellung erscheint. Diese Welt hat sich dem perfekten Plot zu fügen, der längst feststeht, bevor man mit der Realität in Kontakt tritt.“Es ist also Vorsicht geboten.
Doch „besteht die Lösung darin,“ so Pörksen weiter, „auf Stories zu verzichten, wie dies die Puristen der Sachlichkeit verlangen? Gewiss nicht. Die Verbannung der Story als Werkzeug der Welterklärung ist in etwa so realistisch wie die Aufforderung weniger zu atmen, um Sauerstoff zu sparen. Denn wir Menschen sind, um es mit einem Wort des Literaturwissenschaftlers Jonathan Gottschall zu sagen, das Storytelling Animal – das Lebewesen, das Geschichten erzählt. (…) Geschichten sind natürlich auch authentische Dokumente gelebter Moral und konkreter Utopie. Persönliche Neuanfänge, glückende Therapien, Transformation im Privaten und Revolutionen in der Gesellschaft (…).“
Letztendlich fordert Professor Bernhard Pörksen – wie Susan Vahabzadeh, wie Katarina Bader und wie viele andere – das fast Unmöglich von uns. Von Publikum und Storyteller gleichsam:
Es ist „nötig, für den allgegenwärtigen Missbrauch der menschlichen Faszinationsbereitschaft zu sensibilisieren. Denn eines,“ so Pörksen, „ist gewiss: man kann – erzählend – nicht nicht konstruieren. Wann aber wird die unvermeidliche Konstruktion endgültig zur manipulativen Inszenierung, die subjektiv aufbereitete Szene und das atmosphärische Detail zum vermeintlichen Beleg des Vorurteils? Wann wird der Sog der Story – vielleicht zunächst unbewusst, nicht einmal mit böser Absicht – zur Irreführung, zuerst zum Selbst- und dann zum Publikumsbetrug? Das ist die Schlüsselfrage auf dem Weg zu neuer Offenheit und echter Neugier.“
Seid wachsam
Ach, wie schwierig ist das. Und doch wie wichtig. Wir dürfen uns nicht unkritisch dem Storytelling hingeben. Nicht bedingungslosen Eintauchen und in Immersion und Fiktion abtauchen. Dürfen uns nicht kritiklos dem Eskapismus hingeben. Sondern müssen wachsam bleiben und verantwortungsvoll mit der Kraft der Geschichte umgehen – zumindest dort, wo Storytelling in irgendeiner Weise in Bezug zur Realität steht. Anstrengend und unendlich wichtig.
___________________________________________________
Drei Tipps zum Abschluss:
- „Es ist die Lüge, die uns wärmt,“ schreibt Wolf Schneider in seinem großartigen Buch „Die Wahrheit über die Lüge“. Denn Ehrlichkeit ist ein Ideal der Kommunikation und die Lüge hat durchaus ihren Sinn. Wie PR-Manager*innen mit weißen und schwarzen Lügen umgehen und warum sie zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit unterscheiden, konnte man 2017 im pressesprecher lesen. Auch heute noch ist Jeanne Wellnitz Artikel „Nichts als die Wahrheit?“ sehr lehrreich und lesenswert.
- Buchtipp: Wie man sein Narrativ findet und erzählt, das können Sie nachlesen in „Whats your Story? Leadership-Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen“ von Petra Sammer, erschienen bei O´Reilly, 2019
- Seminartipp: Für alle, die praktisch einüben wollen, die richtige Geschichte zu erzählen und dabei glaubwürdig zu wirken, empfehle ich das Tagesseminar „Storytelling“ mit Journalist und Medienprofi Georg von Stein und mir am 17. März in München. Alle Infos: hier